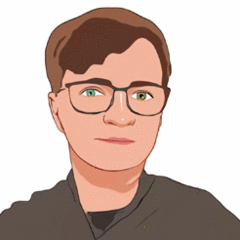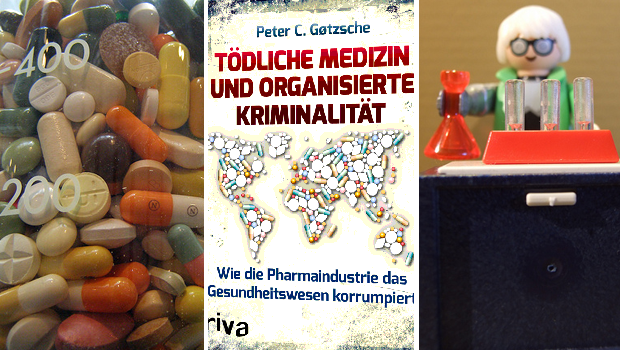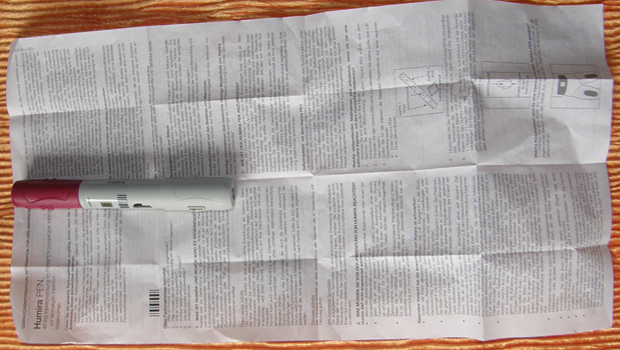Suchen und finden
Beiträge zum Thema 'AbbVie'.
6 Ergebnisse gefunden
-
In der Schweiz sind Plakate der Firma AbbVie von der Aufsichtsbehörde beanstandet worden. Darauf wurde ganz allgemein für Biologika und für das Patientenbetreuungsprogramm geworben. Auf dem Plakat stand: Ein QR-Code führte zu einer Internetseite, auf der die Schuppenflechte im Allgemeinen und Biologika im Besonderen erklärt wurden und Adressen von Hautärzten zu finden waren. Die schweizerische Aufsichtsbehörde Swissmedic, vergleichbar mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland, fand das alles zu nah dran am Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente. Das gleiche Verbot gilt auch in Deutschland. Deshalb bleiben derartige Anzeigen auch hierzulande recht allgemein. Da wird dann "nur" versprochen, dass die Psoriasis vergessen werden kann, wenn man "innovative Medikamente" oder "moderne Medikamente" nimmt. Es wäre auch in Deutschland neu, wenn Werbung beanstandet wird, die halbwegs allgemein für eine Art von Medikamenten wirbt. Das macht im Bereich der Psoriasis zum Beispiel die Firma Janssen so im Mitgliedermagazin des Deutschen Psoriasis-Bundes – und nochmal: Es ist erlaubt. In diesem Artikel wird der Vorgang um AbbVie in der Schweiz erklärt. Die Plakatkampagne pausiert nun. Die Firma will die Sache erst einmal mit SwissMedic klären. AbbVie ist Hersteller unter anderem der Medikamente Humira und Skyrizi.
-
Im November 2014 erschien das Buch "Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität – Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert" des dänischen Medizinforschers Peter C. Gøtzsche auf Deutsch. Schon bei seinem Erscheinen ein Jahr zuvor auf Englisch hat es weltweit Furore gemacht und ist als grandiose Radikal-Kritik an den global agierenden Pharmakonzernen gelobt worden. Gøtzsche behauptet, dass nahezu alle großen Pharmafirmen ihre Medikamente mit Methoden vertreiben, die mehr oder weniger „kriminell“ seien. Tausende Patienten wären gestorben oder hätten schwere Schäden erlitten, weil die Firmen verhindert haben, dass negative Wirkungen eines Medikaments bekannt wurden. Der Autor warnt davor, Informationen über Medikamente unkritisch zu übernehmen. Die Pharmaindustrie setze mit enorm viel Geld und ohne Skrupel ihre Marketing-Interessen auf allen Ebenen durch. Er rät Patienten, mit Medikamenten sehr vorsichtig umzugehen und sie abzusetzen, wenn sie einem zu riskant erscheinen. Gøtzsche ist kein Anhänger einer Alternativ-Medizin. Er fordert für die gesamte Schulmedizin unabhängige, industrie-ferne Experten und Studien. Sein Standpunkt ist eindeutig: Er glaube der Pharmaindustrie nicht, weil sie die Öffentlichkeit wiederholt belogen habe – selbst wenn sie manchmal die Wahrheit sage. Pharmakonzerne begehen Straftaten Als Patient würde man sich wünschen, Gøtzsche wäre ein klassischer „Verschwörungstheoretiker“. Dann könnte man, was er behauptet, als völlig überzogenen Generalverdacht zurückweisen: Die internationalen Pharmakonzerne würden Straftaten begehen, wie man sie von der Mafia und vergleichbaren kriminellen Organisationen kenne und seien verantwortlich für zehntausende Tote. Die vielen Fälle, über die er ausführlich berichtet, sind aber genauso passiert und werden von ihm akribisch belegt. Keinem Pharma-Anwalt ist es gelungen, sein Buch juristisch zu verhindern. Was noch erschreckender ist: Trotz veröffentlichter Skandale, Gerichtsurteile, Vergleiche, Strafgelder, Schadensersatz und Abfindungen in Milliardenhöhe wären das keine Einzelfälle geblieben. Die Zahl der Straftaten nehme weiterhin schnell zu. In den USA würden Pharmariesen dreimal so viele schwere oder mittelschwere Gesetzesverstöße begehen wie andere Unternehmen. Medikamente sind dritthäufigste Todesursache Fast jede Berufsgruppe, die für die Pharmaindustrie von Bedeutung sei, werde mit großen Geldbeträgen bestochen. Kriminalität, Korruption und unzulängliche Überwachung von Medikamenten seien gängige Praxis. Die wissenschaftliche Literatur über Medikamente werde systematisch verfälscht. Manager der Pharmaindustrie würden Ärzte, Patienten, Behörden und Gerichte belügen. Anstelle von unabhängigen Experten bestimmten Pharmakonzerne, was wir von Medikamenten halten sollen. Das erklärt, so Gøtzsche, weshalb Medikamente in den Vereinigten Staaten und in Europa (nach Herzkrankheiten und Krebs) die dritthäufigste Todesursache seien. Das Buch ist derart umfassend, dass es an dieser Stelle nicht vollständig gewürdigt werden kann. Aber es ist so eindrucksvoll, dass „mündige Patienten“ es unbedingt lesen sollten. Zumal es nicht nur sehr verständlich geschrieben ist, sondern auch streckenweise spannend. Diese Buchbesprechung konzentriert sich auf die Aussagen, die uns Psoriatiker interessieren könnten. Pharmahersteller mussten Milliarden Beträge zahlen Der Autor schildert Fälle u.a. von Abbott (AbbVie), Janssen (Janssen-Cilag), Merck (MSD), Novartis und Wyeth (Pfizer) – alles Firmen, die auch Biologika für Psoriasis und Psoriasis arthritis auf den Markt gebracht haben. Sie mussten allein in den USA Strafen zwischen 95 Millionen und 3 Milliarden Dollar zahlen. Die häufigsten Straftaten waren illegale Vermarktung (Ärzten wurde empfohlen, die Medikamente für nicht zugelassene Indikationen zu verwenden) falsche Darstellung von Forschungsergebnissen durch bezahlte Autoren Verschweigen oder Vertuschen schädlicher Wirkungen von Medikamenten Bestechung von Ärzten und Beamten bis hin zu Rabatt-Betrug an öffentlichen Gesundheitsdiensten In 2012 musste z.B. die Firma Amgen 762 Millionen Dollar zahlen, weil sie in den USA u.a. Enbrel® für die leichte Psoriasis propagiert und Ärzten Schmiergelder bezahlt hatte. Dramatisch war der Fall Vioxx, ein nicht-sterioales Anti-Rheumamittel (NSAR) zur Behandlung von Gelenkerkrankungen wie der Psoriasis arthritis. Das Medikament wurde von Merck (MSD) auf den Markt gebracht. Gøtzsche beschreibt, dass es von Anfang an bekannt gewesen sei, dass COX-2-Hemmer das Thrombose-Risiko erhöhen. Kritische Wissenschaftler und Journalisten, die immer wieder darauf hinwiesen, wurden von der Firma systematisch verfolgt, beruflich diffamiert und persönlich bedroht. Das Unternehmen verpflichtete medizinische „Meinungsmacher“ für viel Geld, positive Aussagen zu Vioxx® abzugeben. Merk habe, so der Autor, mit Vioxx® ungefähr 120.000 Patienten durch Thrombosen umgebracht. Viele von ihnen hätten gar nicht mit dem Mittel behandelt werden müssen. Paracetamol hätte die gleiche Wirkung gehabt. Die Firma wurde wegen Betrugs bei der Vermarktung von Vioxx® verurteilt. So zahlte Merck z.B. 2007 in einem Vergleich 4,85 Milliarden Dollar, der ohne die zusätzlichen 1,2 Milliarden Dollar an Anwaltskosten vermutlich noch höher ausgefallen wäre. In 2012 musste die Firma noch einmal als Geldstrafe und Schadenersatz fast 1 Milliarde Dollar zahlen. Die Geschichte der NSAR sei, so Gøtzsche, „eine Horror-Story voller übertriebener, unlogischer oder falscher Behauptungen, Gesetzesverstöße, untätiger Behörden und Nachgiebigkeit gegenüber der Industrie." Mehrere dieser Medikamente mussten vom Markt genommen werden. Die Behauptung, NSAR besäßen eine entzündungshemmende Wirkung sei ein Schwindel. Konkret benennt er z.B. Naproxen, Piroxicam und Benoxprofen und macht Pfizer und Eli Lilly für den Tod hunderter Patienten verantwortlich. Auch bei der bei der Celecoxib-Studie von Pfizer wäre betrogen und gelogen worden. Trotzdem werden NSAR weiter zur Behandlung der Psoriasis arthritis eingesetzt. Pharmaindustrie honoriert Ärzte und Wissenschaftler Pharmaunternehmen würden nie über Vor- und Nachteile ihrer Medikamente sprechen, sondern nur darüber, wie wirksam und ungefährlich sie seien. Als Beleg beriefen sie sich auf Studien, die sie selbst finanziert, vorstrukturiert und ausgewertet hätten. Sie würden Ärzten und Wissenschaftlern extrem hohe Honorare zahlen, nicht selten bar. Gøtzsche stellt fest, dass die meisten Experten eines Fachgebiets auch für die Pharmaindustrie arbeiten. In Dänemark, wo das genehmigt werden muss, haben 39 % der Dermatologen die Erlaubnis, für die Pharmaindustrie zu arbeiten. Damit gäbe es im ärztlichen und im wissenschaftlichen Bereich keine gegenseitige Kontrolle unter Kollegen mehr. Unabhängige Studien gäbe es immer seltener. Sie würden von den Pharmafirmen sabotiert, z.B. indem keine Placebos zur Verfügung gestellt werden. Gøtzsche fordert Gesetze, die eine unabhängige Forschung ermöglichen. Klinische Studien müssten als öffentliche Aufgabe durchgeführt werden. Die Pharmaindustrie, die gegenwärtig erheblich von staatlich finanzierten Universitäten und dem öffentlichen Gesundheitswesen profitiert, könnte das über Steuern mittragen. Der Autor stellt fest, dass die meisten Mitglieder in beratenden Ausschüssen keine „unabhängigen Experten“ seien. Er weist darauf hin, dass in allen Arzneimittel- oder Leitlinien-Ausschüssen und in Wissenschaftlichen Beiräten Ärzte mit finanziellen Verbindungen zu Pharma-Unternehmen sitzen. Selbst wenn „Interessenkonflikte“ offengelegt werden, sei es fraglich, ob sich ein hoch dotierter Berater der Pharmahersteller stets neutral nur von Daten leiten lasse. Das widerspräche der inzwischen weit verbreiteten Kultur der unbegrenzten Gier und des Betrügens. Bei Vorträgen, so Gøtzsche, würden Ärzte Folien zeigen, die offenkundig nicht sie, sondern Pharmaunternehmen vorbereitet hätten. Das kennen wir z.B. von den „Psoriasis-Gesprächen“. Hautärzte laden ihre Patienten ein, um über Schuppenflechte zu referieren. Mal wird der Sponsor gar nicht erwähnt, mal wird der Firma AbbVie allgemein für die Unterstützung gedankt – ohne aber dass die Zuhörer erfahren, was genau die Firma mit Psoriasis zu tun hat. Wir haben nie erlebt, dass die Patienten darüber informiert werden, der Arzt würde jetzt eine vorgegebene Präsentation der Firma AbbVie vortragen. Widerspruch nicht willkommen Wie schwierig es ist, wissenschaftlich Klarheit über ein Medikament zu bekommen, zeigt sich z.B. bei Fumaderm®: Die unabhängigen Mediziner des arznei-telegramms kritisieren das Medikament immer wieder. Sie weisen z.B. auf die unzulängliche Studienlage hin und bemängelten, dass Aufsichtsbehörden viel zu langsam auf die bekannt gewordenen drei Todesfälle reagiert hätten. Der Hersteller Biogen-Idec erklärte seinerzeit, diese Patienten hätten aufgrund ihrer Blutwerte nicht weiter mit Fumaderm behandelt werden dürfen. Die Firma wies darauf hin, dass es bei jetzt fast 200.000 Patientenjahren keine schweren Nebenwirkungen durch Fumaderm® gegeben hätte. Zweifel und Unsicherheit bleiben, weil es keine klärende wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen den unabhängigen Medizinern und den Experten der Pharmafirma gibt. Das bestätigt Gøtzsche, der darauf verweist, dass Widerspruch bei Pharmafirmen nicht willkommen sei. So etwas störe die Geschäfte. Mondpreise der Pharmaindustrie Um den Absatz ihrer Medikamente zu steigern, würden Pharmafirmen Statistiken vorlegen um zu beweisen, dass bestimmte Krankheiten nicht optimal behandelt werden würden. Sie warnen folglich vor einer „Unterbehandlung“. Versorgungsforschung gibt es inzwischen auch bei der Psoriasis. Nicht ganz unerwartet wird seit einigen Jahren verkündet, Psoriasis-Patienten seien unterversorgt. Deutlich kritisiert der Autor die „Mondpreise“ von aktuellen Medikamenten. So sei die Behandlung eines Rheuma-Patienten mit einem Biologikum in Dänemark 120-mal teurer als eine Therapie mit einem konventionellen Mittel. Begründet würden die Preise mit den immensen Forschungsausgaben der Firmen. Tatsächlich aber sei immer wieder nachgewiesen, so Gøtzsche, dass diese völlig überhöht angesetzt werden. Die Ausgaben für Marketing seien doppelt so hoch und Preisabsprachen wären in dieser Branche üblich. Wenn neue Medikamente so gut wären, wie die Pharmaindustrie uns weismachen wolle, wäre es kaum nötig, sie zu pushen und Ärzte zu bestechen, damit sie die Präparate verschreiben. Bezahlen müssen diese exorbitanten Preise die Patienten, die Steuerzahler bzw. die Versicherten der Krankenkassen. Für Gøtzsche ist das „Diebstahl“. Pharmaunternehmen, die solche Preise verlangen, würden sich wie Straßengangster verhalten, denen man schutzlos ausgeliefert sei. Wertung Es fällt schwer, sich der Argumentation von Gøtzsche zu entziehen. Die Vorwürfe sind seriös recherchiert. Seine Schlussfolgerung, die Straftaten von Pharmafirmen seien kriminell, weil sie immer wieder vorkommen und Strafen oder Schadensersatz quasi aus der Portokasse finanziert werden, sind nachvollziehbar. Die unglaublich vielen Todesfälle durch Arzneimittel sind ebenfalls dokumentiert und machen Patienten am meisten Angst. Die positive Wirkung von Psoriasis-Medikamenten ist objektiv nachzuweisen. Man kann messen, wie sich die Plaques zurückentwickeln – klassischerweise mit dem PASI. Todesfälle gab es bei dem Biologikum Raptiva, das daraufhin sofort vom Hersteller Serono (heute Merck-Serono) vom Markt genommen wurde. Schwerwiegende Nebenwirkungen der Biologika sind bei rund 1 Prozent der Patienten möglich. Sie sollen im Register für Psoriasis und im Register für Psoriasis Arthritis gemeldet werden. Gøtzsche führt an, viele Ärzte würden solche Meldungen nicht machen: Das sei viel zu zeitaufwendig und bürokratisch, Pharmavertreter würden sie hinterher bedrängen und nicht immer würde eine Erkrankung mit dem Medikament in Verbindung gebracht. Unsere Erfahrung ist, dass die Dermatologen, die sich zum PsoNet zusammengeschlossen haben, in ihren Schulungen immer wieder auf die Register hingewiesen werden. Patienten sollten unbedingt mit dem Arzt darüber sprechen, wenn die Ursachen für einzelne Erkrankungen nicht zu klären sind. Was bleibt, sind 120.000 Todesfälle nach der Einnahme von Vioxx. Das Medikament wurde auch bei Psoriasis arthritis verschrieben. Der Firma Merck (MSD) wurde vor Gericht vorgeworfen, sie hätte sich eines „arglistigen, repressiven und frevlerischen“ Verhaltens schuldig gemacht. Natürlich hoffen wir alle, dass so etwas nie wieder passiert. Gøtzsche ist da extrem pessimistisch: „Wir trauen keinem Menschen, der uns wiederholt belogen hat, selbst wenn dieser Mensch manchmal die Wahrheit sagt“. Aber welche Alternative haben betroffene Patienten? Der Däne empfiehlt uns, möglichst sparsam Medikamente einzunehmen, bewusst die Vorteile gegen die Nachteile abzuwägen und sich politisch für industrie-ferne Experten und Gremien einzusetzen. Hinweise Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität – Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert Peter C. Gøtzsche, München 2015 Interview mit Peter C. Gøtzsche Süddeutsche Zeitung vom 05.02.2015 Themenverwandte Bücher Patient im Visier – Die neue Strategie der Pharmakonzerne Caroline Walter, Alexander Kobylinski, Hamburg 2010 Weiße Kittel – Dunkle Geschäfte – Im Kampf gegen die Gesundheitsmafia Dina Michels, Berlin, 2009 Korrupte Medizin – Ärzte als Komplizen der Konzerne Hans Weiss, Köln 2008 Der verkaufte Patient – Wie Ärzte und Patienten von der Gesundheitspolitik betrogen werden Renate Hartwig, München 2008 Kranke Geschäfte – Wie die Pharmaindustrie uns manipuliert Markus Grill, Hamburg 2007 Big Pharma –Das internationale Geschäft mit der Krankheit Jacky Law, Düsseldorf 2007
-
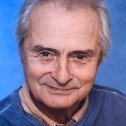
Versorgungsforschung, PR und der direkte Weg zum Patienten
Rolf Blaga erstellte ein Artikel in Magazin
Der Global Player Abbott hat sich in zwei Unternehmen aufgeteilt. Weshalb, werden Wirtschaftsexperten sicherlich analysieren. Dem interessierten Laien fällt auf, dass gerade die Geschäftszweige Abbvie zugeschlagen wurden, die schon bisher besonders hohe Gewinne gemacht haben. AbbVie stellt sich als „forschendes BioPharma-Unternehmen“ vor. Als „Forschungsobjekt“ wird die „Lösung der Gesundheitsversorgung“ genannt. In den vergangenen Jahren ist viel Geld von Pharmafirmen in Studien zur „Versorgungsforschung“ und Befragungen von Patienten durch PR-Agenturen gesteckt worden. Viele große Pharmafirmen sind Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV). Die Industrie will wissen, wie die für sie interessanten Patientengruppen tatsächlich versorgt werden und welche Versorgungslücken existieren. „Versorgungsforschung“ hat in der Vergangenheit Erstaunliches ans Licht gebracht. Zum Beispiel, dass Psoriasis-Patienten in Deutschland mit großem Abstand am häufigsten Kortison zum Einnehmen erhalten. Da das nicht den Leitlinien der Dermatologen entspricht, verschreiben das vermutlich die Hausärzte. Das hätte aber eigentlich eine Aufklärungskampagne bei Allgemein-Medizinern auslösen müssen. „Versorgungsforschung“ ist sinnvoll, wenn ihre Ergebnisse dazu führen, dass sich die Versorgung von Patienten objektiv verbessert. Sie ist zweifelhaft, wenn ihre Ergebnisse dazu genutzt werden, kommerziellen Anbietern Marktlücken aufzeigen. Sie ist problematisch, wenn Anbieter rezeptpflichtiger Medikamente Hinweise bekommen, wie sie ihren direkten Zugang zu Patienten ausbauen können. AbbVie macht dort weiter, wo Abbott aufgehört hat: Kein Pharmakonzern in Deutschland hat versucht, den direkten Kontakt zu den (Psoriasis-) Patienten so zu perfektionieren wie Abbott. Informationsbroschüren, Patientenportale, telefonische Beratung und Hausbesuche durch eine Krankenschwester bieten andere (Biologika-) Hersteller ebenfalls an. Abbott organisiert darüber hinaus mit Apothekern „Psoriasis-Gespräche“, hat einen Standardvortrag für diese Veranstaltung entwickelt, berät telefonisch über Sozialrechtsfragen und versuchte vergeblich, einen „Lieferservice“ für Humira® einzurichten. Dieses „Betreuungsprogramm“ wurden schon in der Vergangenheit von Patientenverbänden deutlich kritisiert: nicht nur von der PSOAG, sondern ebenfalls von der Deutschen Rheuma-Liga. Seit einigen Jahren zeichnet sich ab, dass Pharmafirmen versuchen, ohne den Umweg über die Ärzte direkt die Patienten zu erreichen. Gescheitert ist der Versuch zu erreichen, dass in der EU auch bei Patienten für rezeptpflichtige Medikamente geworben werden darf. Erfolgreich dagegen war die Pharmalobby im Punkt „integrierte Versorgung“: Seit 2011 ist es gesetzlich erlaubt, dass die Krankenkassen die Versorgung kompletter Patientengruppen an kommerzielle Unternehmen abgeben. So lässt die AOK Niedersachsen ihre Schizophrenie-Patienten komplett von der I3G GmbH versorgen, einer 100%-igen Tochter von Janssen-Cilag. Die stellen wiederum Psychopharmaka gegen Schizophrenie her. Auch andere Pharmafirmen würden gerne „ihre“ Patienten selbst versorgen. Kritiker befürchten, dass bestimmte Patientengruppen in Zukunft nur noch mit Pillen behandelt werden. Interessenkonflikte sind programmiert. -
Eben bekam ich einen Anruf von dem super netten und freundlichen Abbott Care Patientenservice. (Humira). Wollten nur mal hören wie es mir geht und ob ich was brauche. Finde ich super toll, hätte doch sonst fast meinen 2wöchentlichen Spritztermin vergessen. Natürlich ist das bei dem Preis sicherlich nicht ganz uneigennützig. Ich finds halt im Moment richtig positiv.
-
Hallo, ich bin seit einiger Zeit Humira-Patient und werde wohl aus beruflichen Gründen 2019 zunächst in Schweden und 2020 in Dänemark verbringen. Wisst Ihr, ob es dort genau wie in Deutschland Patientenunterstützung in Form von Krankenschwester-Besuchen oder gar einen Lieferdienst für Humira-Medikamente von Abbvie gibt? Viele Grüße Euer Peter
- 1 Antwort
-
- AbbVie
- Humira Erfahrungen
-
(und 1 mehr)
Markiert mit:
-
Name des Originalpräparats: Humira Namen von Biosimilars: Amgevita, Amsparity, Cyltezo, Halimatoz, Hefiya, Hukyndra, Hulio, Hyrimoz, Imraldi, Solymbic, Yuflyma Name des Wirkstoffs: Adalimumab Hersteller des Originalpräparats: AbbVie Dieses Medikament ist rezeptpflichtig. Allgemeine Informationen Adalimumab gehört zur Gruppe der so genannten Biologika. Diese Stoffe heißen so, weil sie von lebenden Zellen hergestellt werden – mit „Bio“ wie man es vom Lebensmittelmarkt kennt hat das nichts zu tun. Bei Adalimumab handelt es sich um einen gentechnisch hergestellten humanen Antikörper gegen löslichen Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF-α). Bei welcher Erkrankung wird Humira angewandt? Humira kann bei Erwachsenen sowohl bei Psoriasis arthritis als auch bei mittelschwerer bis schwerer chronischer Schuppenflechte vom Typ Plaque-Psoriasis angewandt werden. Bei Psoriasis arthritis wird Humira allein (Monotherapie) oder in Kombination eingesetzt, wenn herkömmliche krankheitsmodifizierende Antirheumatika nicht ausreichend wirken. Bei Plaque-Psoriasis wird es als Monotherapie bei Patienten angewandt, bei denen eine äußerliche Therapie mit Cremes, Salben und Bädern nicht ausreicht und eine Systemtherapie erforderlich ist. In der Regel wird ein Biologikum wie Humira aber erst eingesetzt, wenn andere Systemtherapien wie Fumarsäureester, Retinoide, Methotrexat oder Ciclosporin nicht ausreichend gewirkt haben. Humira kann bei Kindern mit Plaque-Psoriasis ab 4 Jahren eingesetzt werden, wenn äußerliche Therapien und eine Lichttherapie nicht angesprochen haben oder aus einem anderen Grund für sie nicht geeignet sind. Darüber hinaus wird Humira auch bei vielen anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew und Morbus Crohn eingesetzt. Wirkmechanismus Der Tumor-Nekrose-Faktor (TNF-alpha) ist ein wichtiger Bestandteil des körpereigenen Abwehrsystems gegen Bakterien. Er schafft die Vorraussetzungen für andere Zellen und Eiweißstoffe, im Kampf gegen Bakterien optimal zu funktionieren. TNF-α wird vor allem von Makrophagen ausgeschüttet und hat vielfältige Wirkungen in vielen Organsystem. Eine lokal erhöhte Konzentration von TNF führt zu den klassischen Entzündungssymptomen: Hitze, Schwellung, Röte und Schmerz. Erhöhte Konzentrationen im Blut können zu Fieber und Appetitminderung mit Gewichtsverlust führen. Bei chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Psoriasis ist TNF-α außer Kontrolle geraten. Man findet den Faktor in hohen Konzentrationen, obwohl Bakterien bei dieser Entzündung gar nicht mit im Spiel sind. Die eigentlich gegen Bakterien gerichtete Entzündungsreaktion mit all ihren Folgen wie Schmerz, Rötung und Gewebezerstörung läuft sozusagen ins Leere. Indem man TNF- α aus dem Spiel nimmt, kann man die Entzündungsreaktion ausbremsen. Adalimumab ist ein Antikörper gegen löslichen TNF-α. Durch die Bindung an den Antikörper passt TNF-α nicht mehr ins „Schloss“ (Rezeptor) und kann seine Wirkung in den Zielorganen nicht entfalten. Wie wird Humira angewandt? Es wird empfohlen, dass die Behandlung mit Humira von speziellen Fachärzten eingeleitet und überwacht wird, die über viel Erfahrung mit diesem Medikament verfügen. Humira gibt es als Spritze und als Pen. Mit dem Pen sollen Menschen mit schweren Gelenkproblemen an den Händen bei der Injektion des Medikaments weniger Probleme haben. Wer schon einmal einem Diabetiker beim Spritzen zugesehen hat, wird sich spontan daran erinnert fühlen: Beim Pen ist die Nadel während des Injektionsvorgangs nicht sichtbar. Die Patienten halten den Humira-Pen gegen die Haut, drücken einen Knopf und warten auf die Injektion des Medikaments. Die Injektion selbst wird nach Angaben des Herstellers AbbVie von Patienten beim Pen als weniger schmerzhaft empfunden. Für den Pen gab es eine Studie. Die hieß Touch (Trial Of Usability in Clinical settings of HUMIRA Autoinjector vs. Prefilled Syringe). 52 Patienten nahmen daran teil. Neun von zehn fanden den Pen bequemer und einfach zu handhaben. Acht von zehn berichteten von weniger Schmerzen. Bei Psoriasis arthritis wird in der Regel alle zwei Wochen als Einmalgabe 40 mg des Antikörpers unter die Haut (subkutan) gespritzt. Bei Plaque-Psoriasis wird bei erwachsenen Patienten ein Anfangsdosierung von 80 mg Adalimumab subkutan empfohlen. Die nächste Gabe von 40 mg erfolgt nach einer Woche, danach werden wie bei der Psoriasisarthritis alle zwei Wochen 40 mg verabreicht. Für Kinder mit Plaque-Psoriasis ab 4 Jahren beträgt die empfohlene Dosis 0,8 mg pro Kilogramm Körpergewicht und maximal 40 Milligramm. Die genaue Dosis kann der Arzt in der Fachinformation finden. In den ersten beiden Wochen wird Humira wöchentlich, da nach alle zwei Wochen unter die Haut gespritzt. Bei Patienten, bei denen sich auch nach 16 Wochen noch keine Wirkung gezeigt hat, sollte Humira abgesetzt werden. Bei guter Wirksamkeit kann nach 33 Wochen eine Unterbrechung der Therapie erwogen werden. Studien haben gezeigt, dass bei knapp drei Viertel der Patienten nach diesem Zeitraum keine Rückfälle mehr auftreten. Grundsätzlich ist es möglich, dass man sich als Patient nach entsprechender Schulung das Medikament selbst injiziert. Ob das auch für dich in Frage kommt, solltest du mit deinem Arzt besprechen. Wann darf Humira nicht angewendet werden? bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (auch bei Latex-Allergikern ist Vorsicht geboten, da der Nadelschutz der Spritze Latex enthält) bei aktiver Tuberkulose bei schweren Infektionen wie Blutinfektion (Sepsis) bei Infektionen mit Keimen, die normalerweise harmlos sind (Solche „opportunistischen“ Infektionen sind ein Anzeichen für ein geschwächtes Immunsystems) bei mittelschwerer bis schwerer Herzinsuffizienz Worauf müssen Arzt und Betroffener besonders achten? Besonders gefürchtet ist unter der Behandlung mit Humira das Wiederaufflackern einer nicht richtig ausgeheilten Tuberkulose (Tbc). TNF-α ist in besonderer Weise daran beteiligt, Tuberkelbakterien dauerhaft in Schach zu halten. Fällt dies Wirkung weg, kann die Tuberkulose erneut ausbrechen und dann zu schweren Krankheitsverläufen führen. Ihr Arzt wird Sie daher ausführlich befragen, ob Sie jemals an einer Tbc erkrankt waren oder Kontakt mit Tbc-Kranken hatten. Zusätzlich wird unter Umständen mittels Röntgenaufnahme und/oder Hauttest (Tuberkulin-Test) nach einer inaktiven (latenten) Tuberkulose gefahndet. Wird eine aktive Tuberkulose festgestellt, darf mit der Therapie mit Humira nicht begonnen werden. Bei einer inaktiven Tuberkulose wird zuerst eine Anti-Tuberkulosetherapie eingeleitet. Auch wenn sich vor der Therapie keine Hinweise für eine Tuberkulose ergeben haben, ist eine spätere Infektion oder ein Wiederaufflackern nicht völlig ausgeschlossen. Sie sollten daher während des Behandlungszeitraums besonders auf mögliche Anzeichen einer Tuberkulose wie anhaltender Husten, Gewichtsverlust, niedriges Fieber und Nachtschweiß achten und ggf. sofort Ihren Arzt informieren. Auch andere Infektionen können unter Humira gehäuft auftreten bzw. schwerer verlaufen. Ihr Arzt wird daher versuchen, Infektionen vor der Behandlung weitgehend auszuschließen. Tritt eine schwere Infektion während der Behandlung auf, muss die Behandlung mit Adalimumab möglicherweise abgebrochen werden, bis die Infektion unter Kontrolle ist. Auch eine chronische Hepatitis B. sollte möglichst ausgeschlossen werden. Einige Menschen sind Träger des Hepatitis-B-Virus ohne davon zu wissen. Die Therapie mit Adalimumab könnte das Virus aktivieren. Auch opportunistische Infektionen mit ansonsten harmlosen Erregern einschließlich Pilzerkrankungen können auftreten. Symptome wie Unwohlsein, Fieber, Gewichtsverlust, Schwitzen, Husten und Atemnot müssen daher immer ernst genommen werden. Beim heutigen Wissenstand kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass TNF-Gegenspieler wie Adalimumab das Risiko für Lymphome und andere bösartige Erkrankungen erhöhen. Dies gilt vor allem für Patienten mit einer intensiven abwehrschwächenden (immunsuppressiven) Therapie in der Vorgeschichte. Wurde vorher eine PUVA-Therapie durchgeführt, sollte vermehrt auf die mögliche Entstehung von Hautkrebs geachtet werden. Manche Impfstoffe enthalten lebende Erreger. Auf Impfungen mit solchen Lebend-Impfstoffen sollte während der Therapie mit Humira verzichtet werden. Dazu gehören z.B. Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Gelbfieber und Typhus. Impfungen mit Tot-Impfstoffe stellen kein Problem dar. Besondere Vorsicht ist auch bei Patienten mit leichter Herzschwäche (Herzinsuffizienz) geboten, da sich diese unter Umständen verschlechtern kann. Bei Neuauftreten einer Herzschwäche oder Verschlechterung der Symptomatik muss die Therapie abgesetzt werden. Kann Humira in Schwangerschaft und Stillzeit angewandt werden? Da nicht genug Erfahrungen in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Präparat hier nicht eingesetzt werden. Während der Behandlung ist eine sichere Empfängnisverhütung zu empfehlen. Mögliche Nebenwirkungen Sehr häufig (bei einem von 10 Behandelten oder mehr) Reaktionen an der Injektionsstelle wie Rötung, Schwellung, Schmerz, Juckreiz (bei 16% der Patienten – meist mild und kein Grund zum Absetzen) Häufig (bei mehr als einem von 100 Behandelten aber weniger als bei einem von 10) Infektionen der oberen und unteren Atemwege (Schnupfen, Halsentzündungen, Bronchitis, Lungenentzündung), Virusinfektionen (einschließlich Grippe und Herpesinfektionen), Hefepilzerkrankungen (Candidiasis), andere bakterielle Infektionen (z.B. Harnwegsinfektionen) Lymphopenie (Rückgang der Lymphozyten) Benommenheit (einschließlich Schwindel), Kopfschmerz, neurologische Empfindungsstörungen (z.B. „Ameisenlaufen“) Infektion, Reizung oder Entzündung des Auges Husten, Schmerzen im Bereich von Nasen- und Rachenraum Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit Entzündungen und kleine Geschwüre der Mundschleimhaut (Stomatitis) Erhöhung der Leberenzyme Hautausschläge (Dermatitis, Ekzem), Juckreiz (Pruritus) Haarausfall Schmerzen im Bereich von Muskulatur und Skelett Fieber, Müdigkeit/Abgeschlagenheit, Unwohlsein Gelegentlich (bei mehr als einem von 1000 Behandelten aber weniger als bei einem von 100) Sepsis (Blutinfektion), opportunistische Infektionen, Abszess, Gelenkinfektionen, Hautinfektionen (einschließlich Weichteilinfektion und Impetigo), oberflächliche Pilzinfektionen Blutbildveränderungen (Neutropenie bis hin zu Agranulozytose, Leukopenie, Thrombozytopenie, Anämie, Leukozytose) Lymphknotenschwellungen Hautpapillom, Basalzellkarzinom der Haut Systemischer Lupus erythematodes, Angioödem Arzneimittelüberempfindlichkeit, saisonale Allergien Kaliummangel (Hypokaliämie), erhöhte Blutfette, erhöhte Harnsäurespiegel (Hyperurikämie) Appetitstörungen (bis hin zu Abmagerung) Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit (einschließlich Nervosität und Agitation) Ohnmacht (Synkope), Migräne, Zittern (Tremor), Schlafstörungen Störungen des Sehvermögens, Empfindungsstörungen des Auges Tinnitus, Ohrbeschwerden (einschließlich Schmerz und Schwellung) Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie), schneller Herzschlag (Tachykardie), Herzklopfen Blutdruckerhöhung, Gesichtsrötung (Flush), blaue Flecken (Hämatome) Asthma, Kurzatmigkeit (Dyspnoe), Heiserkeit (Dysphonie), verstopfte Nase Blut im Stuhl, Magenschleimhautentzündung (Gastritis), Erbrechen, Dyspepsie, Blähungen, Verstopfung Nesselsucht (Urtikaria), Schuppenflechte (Psoriasis), Ekchymose und vermehrte Blutergüsse, Purpura Blut im Urin (Hämaturie), eingeschränkte Nierenfunktion, Blasen- und Harnröhrenbeschwerden Störungen des Menstruationszyklus und Blutungsstörungen Erhöhung der Kreatinphosphokinase im Blut, Verlängerung der partiellen Thrombinzeit, Nachweis von Auto-Antikörpern Versehentliche Verletzung, beeinträchtigte Wundheilung Selten: (mehr als einer von 10.000 Behandelten aber weniger als einer von 1000) Nekrotisierende Faszitis, virale Hirnhautentzündung (Meningitis), Divertikulitis Lymphom, andere Organtumoren (einschließlich Brust, Eierstock, Hoden), Plattenepithelkarzinome der Haut, schwarzer Hautkrebs (malignes Melanom) Schwere Blutbildveränderung (Panzytopenie), idiopathische thrombozytopenische Purpura Serumkrankheit Schilddrüsenfunktionsstörung (einschließlich Kropf) zu hohe oder zu niedrige Kalziumspiegel (Hyperkalzämie oder Hypokalzämie) Multiple Sklerose, Gesichtslähmung Panophthalmie, Regenbogenhautentzündung (Iritis), Glaukom Hörverlust Herzstillstand, Koronarinsuffizienz, Angina pectoris, Perikarderguss, dekompensierte Herzinsuffizienz Gefäßverschluss, Aortenverengung (Aortenstenose), Venenentzündung (Thrombophlebitis), Aortenaneurysma Lungenödem, Rachenödem, Pleuraerguss, Rippenfellentzündung (Pleuritis) Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis), intestinale Stenose, Kolitis, Enteritis, Ösophagitis Lebernekrose, Hepatitis, Leberverfettung, Gallensteine, erhöhtes Bilirubin im Blut Erythema multiforme, Pannikulitis Rhabdomyolyse Eiweißausscheidung im Urin (Proteinurie), Nierenschmerzen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Wirkstoffen Wechselwirkungen mit anderen zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen eingesetzten Medikamenten wie Sulfasalazin, Hydroxychloroquin, Leflunomid, Gold, Glukokortikoiden, Salicylaten; nicht-steroidalen Antiphlogistika oder Analgetika sind nicht zu erwarten. Die Kombination mit Methotrexat hat sich als günstig erwiesen, da in diesem Fall seltener Antikörper gegen Adalimumab gebildet werden und die Wirkung verstärkt wird. Die Kombination mit einem weiteren TNF-α-Gegenspieler bringt keinen klinischen Vorteil und erhöht die Infektionsgefahr, sodass davon abgeraten wird. Das gleiche gilt für die Kombination mit Anakinra. Was sollte man sonst noch wissen? Bei Psoriasis-Arthritis kann Humira die klinischen Zeichen der Gelenkentzündung bessern und das Fortschreiten der Gelenkentzündungen vermindern. Auch eine deutliche Verbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeit ist gezeigt worden. Bei mäßiger bis schwerer Plaque-Psoriasis kann mit Adalimumab eine rasche Rückbildung der Hauterscheinungen bis hin zum völligen Abheilen erreicht werden. Die Biologika Humira und Enbrel sind vor allem für die Langzeittherapie einer stabilen, ständig fortschreitenden Psoriasis geeignet. Ein besonders schnelles Ansprechen in kritischen Situationen erreicht man dagegen mit Infliximab und Ustekinumab. Nach einer Therapiepause kann nicht garantiert werden, dass man bei einem Rückfall wieder genauso gut auf die Therapie mit Adalimumab anspricht. Wird das Therapieziel nach 12 Wochen mit Humira nicht erreicht, kann mit Methotrexat kombiniert werden. Bringt auch das keinen Erfolg kann der Wechsel auf ein anderes Biologikum erwogen werden. Maria Weiß, Ärztin Lagerung Die Fertigspritzen müssen im Kühlschrank (2 bis 8°C) aufbewahrt werden. Um den Inhalt vor Licht zu schützen, sollte man die Spitzen in der Originalverpackung lassen. Kosten von Humira Eine Packung mit 2 Pen mit je 40 mg Adalimumab (Humira) kostet etwa 990 Euro (Stand August 2022). Eine Packung mit 6 Pen mit je 40 mg Adalimumab (Humira) kostet etwa 2859 Euro (Stand August 2022). Die Preise sind Listenpreise. Durch Rabattverträge, die Verschreibung eines Biosimilars und weitere Umstände können (und werden) die Kosten davon abweichen. Deshalb ist diese Angabe nur als sehr grobe Richtschnur anzusehen. Verwendete Literatur: Fachinformation Humira Frank Bachmann et al; Stellenwert der Biologika im Praxisalltag; AP Dermatolgie/Allergologie 2009; 4: 28-31 Kurz gemeldet 2024: Amgevita, ein Biosimilar von Humira, ist nun höher konzentriert. Dadurch verringert sich der Zeitaufwand des Spritzens. Außerdem ist Amgevita drei Jahre lang haltbar. [Quelle] November 2019: Imraldi, ein Nachahmer-Präparat (Biosimilar), kostet in Deutschland jetzt nur noch halb so viel wie das Original-Produkt Humira. [Quelle] November 2019: Nach dem Ende des Patentschutzes für das Medikament Humira hatte der Hersteller AbbVie starke Umsatzverluste erwartet. Sie fielen mit 3,9 Prozent weltweit dann geringer aus als befürchtet. [Quelle] Oktober 2019: Ein Jahr nach Auslaufen des Patentschutzes wird das Medikament Humira nur noch halb so oft verschrieben. Biosimilars – die Nachbauten des Original-Arzneimittels – haben also kräftig aufgeholt. [Quelle] Oktober 2018: Das Biosimilar Cyltezo kommt erst einmal nicht auf den Markt. Grund sind wohl Patent-Streitereien in den USA. November 2016: Pen, Spritze und Verpackung bei Humira wurden leicht geändert. Pen und Spritze enthalten nur noch die halbe Füllmenge. Die Zahlen auf dem Pen sind nun weiß und das Sichtfenster ist größer. Bei der Spritze ist deutlich zu sehen, dass sie weniger Inhalt hat. Verringert wurde laut Hersteller die Menge der Füllstoffe und nicht die des Wirkstoffs. Alles in allem soll die Injektion weniger brennen. In einem Flyer gab es den Hinweis, dass Anwender des Pens weiterhin nach dem Auslösen bis 10 zählen sollten. Tipps zum Weiterlesen In unserer Community tauschen Betroffene ihre Erfahrungen mit Humira aus. Wer Humira bekommt, kann an einem Patientenbetreuungsprogramm teilnehmen. Dafür kann man sich bei AbbVie Care anmelden. aktueller Beipackzettel von Humira eine Übersicht über Humira und warum es in der EU zugelassen ist von der europäischen Arzneimittel-Behörde EMA (PDF)
- 18 Kommentare
-
- AbbVie
- Adalimumab
-
(und 2 mehr)
Markiert mit:
-
Erfahrungen austauschen über das Leben mit Schuppenflechte, Psoriasis arthritis und dem ganzen Rest