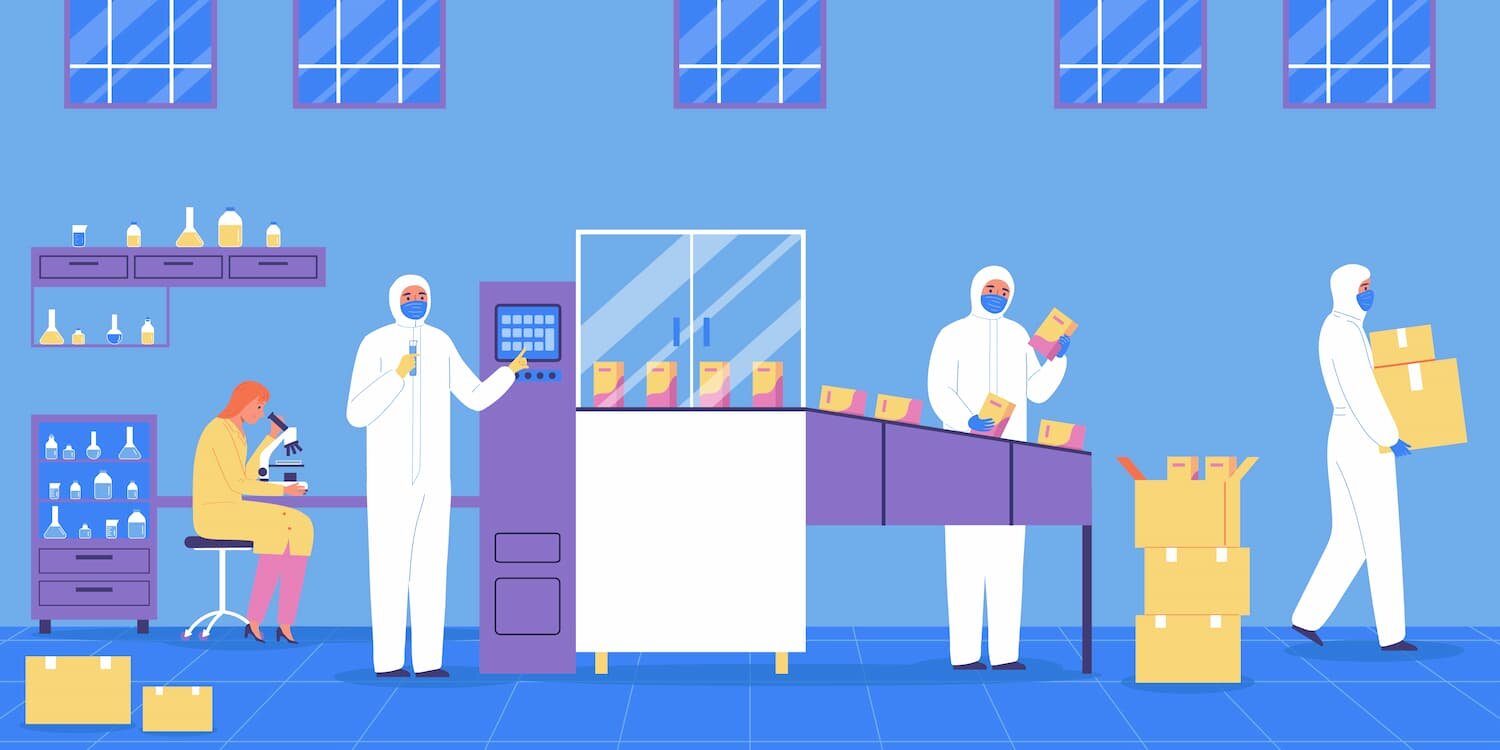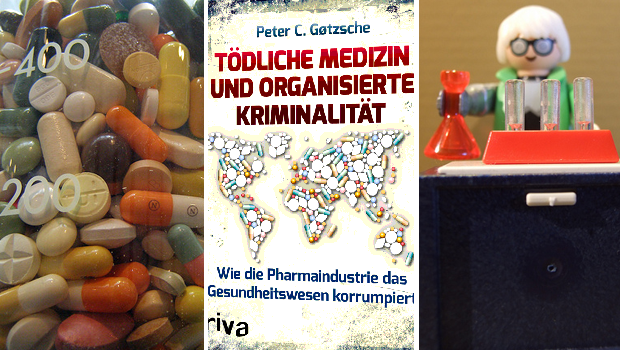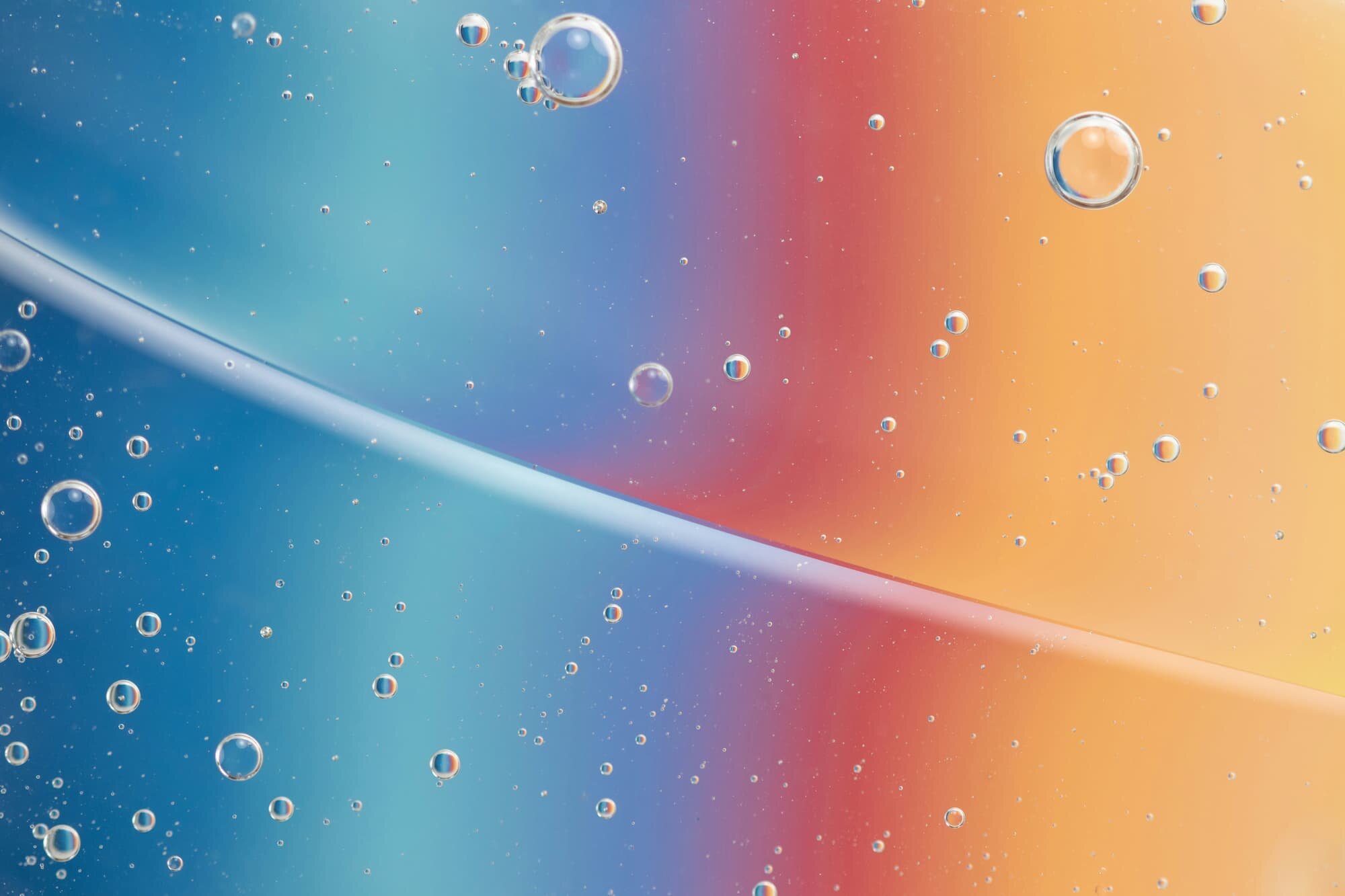Suchen und finden
Beiträge zum Thema 'Pharmaindustrie'.
20 Ergebnisse gefunden
-
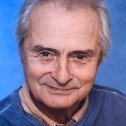
Journalistenpreis für Artikel über Psoriasis – seriöse Ehrung oder reine PR-Kampagne?
Rolf Blaga erstellte ein Artikel in Selbsthilfe
Der Deutsche Psoriasis-Bund (DPB) und der Biologic-Hersteller Merck-Serono haben am 29. Oktober 2007 erstmals einen Journalistenpreis für den besten Artikel zum Thema "Schuppenflechte" überreicht. Preisträgerin war die dpa-Redakteurin Annika Graf. Sie erhielt für ihren Artikel 3000 Euro – gestiftet vom Hersteller des Psoriasis-Medikaments Raptiva. Ist das eine ernstzunehmende Auszeichnung oder lediglich eine PR-Aktion? Der Fakt Aus neun eingereichten Artikeln wurde als bester ausgewählt: "Salz und Sonne: Die 'eine' Therapie der Schuppenflechte gibt es nicht" von Annika Graf (dpa-Themen-Redaktion). Nach Meinung der Jury stelle dieser Artikel eine "herausragende journalistische Leistung" dar, von der eine "starke Signalwirkung" ausgehen würde. Der Preis solle dazu beizutragen, "Schuppenflechte zu enttabuisieren, die Öffentlichkeit über diese chronische Krankheit aufzuklären und der Ausgrenzung der Kranken entgegen zu wirken" – so die Vertreter der Pharmafirma und des Deutschen Psoriasis-Bundes bei der Übergabe der Urkunde. Unser Kommentar Oberflächlichkeit vorprogrammiert Viele Psoriatiker erfahren, dass sie im öffentlichen Leben gemieden werden: Da ekeln sich Menschen vor einem, Hautkontakte werden vermieden – aus Angst, sich anzustecken, oder es fallen gehässige Bemerkungen. Deshalb ist es zu begrüßen, wenn Journalisten aufklärende Artikel über Psoriasis für eine breite Leserschaft schreiben. In dem Artikel wird aber überwiegend darüber berichtet, wie die Schuppenflechte behandelt werden kann. Gehört das wirklich in eine Tageszeitung oder in eine Wochenzeitschrift? Selbst seriöse Versuche werden daran scheitern, dass man aus Platzgründen oberflächlich bleiben muss. Da sind Fachbücher für Betroffene, Patientenzeitschriften, Internetportale und nicht zuletzt die Hautärzte und Rheumatologen sicherlich angemessene Informationsquellen. Unklar ist, in welchen Zeitungen der dpa-Artikel tatsächlich erschienen ist und ob er wirklich ein breites Publikum erreicht hat. Erfahrungen von Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis: Schau Dich in unserem Forum um. Fehlende Neutralität Der Artikel war nicht neutral. Die Preisverleiher – DPB und Merck-Serono – profitierten vom Inhalt: Die zitierte Patientin war eine langjährige Funktionärin des DPB. Das wird im Artikel werbewirksam erwähnt. Andere Psoriasis-Initiativen kommen nicht vor. Korrekt steht anfangs im Artikel, dass die Krankheit nicht heilbar sei. Aber das Fazit am Ende des Artikels lautet: "Da haben Biologics wirklich geholfen". Ist das die preisgekrönte Signalwirkung an die Psoriasis-Kranken? Merck-Serono stellte damals das Biologikum Raptiva her. Die Werbung dafür lautete in 2004: "Es gibt Hilfe!". Der Artikel ist oberflächlich und enthält grobe Vereinfachungen. Vereinfacht wird behauptet, die Psoriasis würde "häufig" durch eine Infektion ausbrechen. Das aber ist nur einer von sehr vielen ebenso häufigen Auslösern. Die Autorin spricht von "Schuppenflechten" in der Mehrzahl, also ob wir Psoriatiker gleich mehrmals erkrankt seien. Der Ausdruck "Kampf gegen die Krankheit" weist in eine völlig falsche Richtung: Psoriasis ist nicht zu bekämpfen, weil sie chronisch ist. Nur, wer seinen Frieden mit ihr schließt und alles unternimmt, um lange erscheinungsfrei zu bleiben, kann seine Krankheit bewältigen. Frau Bieber berichtet, dass sie offen mit anderen Leuten über ihre Krankheit spricht. Wie aber schaffen das diejenigen, die sich das nicht trauen? Nagel-Veränderungen werden in nur einem Satz als "Grübchen" verharmlost. Die knappe und unvollständige Aufzählung von äußerlichen und inneren Therapien gibt keinen Hinweis darauf, wann was sinnvoll eingesetzt wird. Den Begriff "Derivat" für ein Medikament wird ein normaler Zeitungsleser nicht einordnen können. Der Wirkstoff "Anthralin" wird üblicherweise als "Dithranol" bezeichnet. Psoriasis arthritis (PsA) wird nicht als gefährliche Erkrankung der Gelenke und Weichteile beschrieben. Die Aussage, eine Gelenk-Psoriasis tritt zehn Jahre nach den Hauterscheinungen auf, ist zu absolut. Das ist nicht immer so. Die Botschaft, es gäbe "ganz neue Hoffnungen", unterschlägt, dass auch die Biologics nicht bei allen helfen. Leicht durchschaubare PR-Aktion Das ist kein Artikel, in dem ein breites Publikum, das heißt eine nicht betroffene Öffentlichkeit, über Psoriasis aufgeklärt wird. Dann hätte viel mehr beschrieben werden müssen, wie Psoriatiker von manchen Mitmenschen behandelt werden, wie sie sich dabei fühlen und welches die gängigen Vorurteile über diese (und andere) Hautkrankheiten sind. Der Artikel ist in engster Zusammenarbeit mit einem der Preisverleiher entstanden. Alle zitierten Ärzte arbeiten eng mit dem DPB zusammen. Es fehlt die sachliche Distanz des Preisträgers zum Preisverleiher. Dieser Journalistenpreis ist kein Qualitätssiegel, sondern eine leicht durchschaubare PR-Aktion. Es ist nicht zu erwarten, dass kritische Journalisten jemals die Chance haben, diesen Preis zu bekommen. Zum Thema Pharmaindustrie und Gefälligkeits-Journalismus empfehle ich: Big Pharma is watching you von Karen Dente, DIE ZEIT Nr. 15 vom 06.04.06.-
- Pharmaindustrie
- Psoriasis Selbsthilfe
-
(und 2 mehr)
Markiert mit:
-

Studie: Pharmaindustrie manipuliert Selbsthilfegruppen
Redaktion erstellte ein Artikel in Selbsthilfe
Krankenkassen wollten wissen, ob Pharmafirmen die Arbeit von Selbsthilfegruppen beeinflussen. Dafür gaben sie eine Studie in Auftrag. In einem ersten Bericht wurden Ergebnisse auch im Bereich der Selbsthilfegruppen für Psoriatiker vorgestellt. Die "Selbsthilfe-Fördergemeinschaft der Ersatz-Krankenkassen" hat in 2006 wissenschaftlich untersuchen lassen, ob und wie Pharmafirmen bundesweit tätige Patienten-Vereinigungen beeinflussen. Beispielhaft wurden fünf Krankheiten ausgesucht, für die in letzter Zeit neue und sehr teure Medikamente zugelassen wurden. Darunter war auch die Psoriasis, die seit einiger Zeit mit Biologika behandelt werden darf. Deshalb wurden auch die beiden größten Patientenorganisationen für Schuppenflechte durchleuchtet - der Deutsche Psoriasis Bund (DPB) und die Psoriasis Selbsthilfe Arbeitsgemeinschaft (PSOAG). Auf einer Pressekonferenz am 29. November 2006 wurden die ersten Ergebnisse in einem "Werkstattbericht" vorgestellt. Von den beiden untersuchten Psoriasis-Verbänden fiel der DPB negativ auf. Bei dieser Patientenorganisation fanden die Wissenschaftler alle Fakten erfüllt, die sie als direkte oder indirekte Einflussnahme der Pharmaindustrie bezeichnen würden. Auf der Pressekonferenz verwahrte sich Hans-Detlef Kunz, Geschäftsführer des DPB, gegen diese Aussage: "Der Deutsche Psoriasis Bund ist eine seriöse Organisation." Rolf Blaga, Vorstandsmitglied der PSOAG, verkündete, dass seine Organisation künftig erst einmal keine Gelder von der Pharmaindustrie annehmen werde. Man wolle sich deutlich abgrenzen, um nicht auch in den Verdacht zu geraten, Teil eines Netzwerks der Pharmaindustrie geworden zu sein. Untersuchungsergebnisse insgesamt Dr. Kirsten Schubert und Professor Gerd Glaeske vom Bremer Zentrum für Sozialpolitik wollen mit ihrer Studie die Diskussion zwischen Krankenkassen und Selbsthilfeorganisationen vorantreiben. Sie untersuchten den "Einfluss des pharmazeutisch-industriellen Komplexes auf die Selbsthilfe", so der Titel der Untersuchung. Die Wissenschaftler zeigen, dass ein Trend aus den USA auch nach Europa übergeschwappt ist: Einige Pharmakonzerne binden Selbsthilfevereinigungen systematisch in ihre Marketingstrategien ein. Die Arzneimittelkonzerne hätten erkannt, so Dr. Schubert, dass Patientenorganisationen großen Einfluss auf die Verschreibung und den Verkauf von Medikamenten haben können. In den USA würde ein Dollar für die Patientengruppen zu mehr als vier Dollar Umsatzsteigerung führen, ergänzte Professor Glaeske. Dagegen würden direkte Arztkontakte deutlich unter zwei Dollar bringen. Die Pharmaindustrie nutze die chronische Finanznot der Selbsthilfeorganisationen aus. Er forderte den Gesetzgeber auf, die Selbsthilfe finanziell so abzusichern, dass sie nicht auf Industriegelder angewiesen sei. Dr. Schubert warnte: "Die Informationen, die Patienten heutzutage von einigen Selbsthilfegruppen bekommen, sind längst nicht mehr frei von Wirtschaftsinteressen!". Die Bremer Wissenschaftler untersuchten in der Studie den Einfluss der Pharmaindustrie auf acht große Selbsthilfeverbände für Alzheimer, Neurodermitis, Osteoporose, Parkinson und Schuppenflechte. In sechs Mitgliederzeitschriften (75,5 Prozent) war die Pharmaindustrie mit direkter Werbung vertreten. In sieben Mitgliederzeitschriften (87,5 Prozent) fanden sich auch im redaktionellen Teil Publikationen über Pharmaprodukte. Auf sechs Verbands-Internetseiten (75,5 Prozent) traten Pharmafirmen indirekt auf. Auf vier der Verbands-Internetseiten (50 Prozent) gab es direkte Links zur Pharma-Industrie und zu medizintechnischen Anbietern. In fünf Beiräten saßen Wissenschaftler, die nicht allein den Patienten verpflichtet waren, sondern zusätzlich Sponsoring-Verbindungen zur Industrie hatten. Das wurde in keinem Fall von den Beiräten den Vereinsmitgliedern gegenüber offen gelegt. Erst auf Nachfrage der Wissenschaftler wurden diese finanziellen Zusammenhänge angegeben. Bei einem Viertel der Selbsthilfegruppen liegt die Finanzierung über Sponsoring bei knapp 20 Prozent (1). Fünf Prozent der Gruppen und Organisationen erhalten die Hälfte ihres Budgets aus Sponsoringmitteln (1). Die Studie nennt weitere Beispiele, wodurch sich die Pharmaindustrie das Wohlverhalten von Selbsthilfeorganisationen sichert: Arzneimittelwerbung auf Selbsthilfeveranstaltungen oder Förderkreise, in denen Pharmafirmen hohe Mitgliedsbeiträge einzahlen. Als Beispiel wird dafür der Deutsche Psoriasis Bund genannt. Existiert keine Patientenvereinigung, gründen Firmen selbst eine. Die Studien nennt die Koalition Brustkrebs. Andere Pharmafirmen haben Selbsthilfe-Domains reserviert und auch benutzt, zum Beispiel www.selbsthilfe.de (BASF) oder www.leben-mit-ms.de. Erfahrungen von Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis: Schau Dich in unserem Forum um. Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente bei Patienten ist nach dem Heilmittelwerbe-Gesetz verboten. Mit den in der Studie beschriebenen Aktivitäten würden die Arzneimittel-Anbieter aber dieses Verbot umgehen, kritisierte Professor Glaeske. Sogar Arzneimittel, die noch nicht zugelassen sind, würden innerhalb der Selbsthilfe beworben. "Nur, wenn erkennbar ist, wer hinter einer Botschaft steckt, können die Patienten gezielt nach anbieterunabhängigen Informationen Ausschau halten", so Professor Glaeske. Er forderte die Selbsthilfegruppen auf, Transparenz innerhalb der eigenen Organisationen zu schaffen. "Die Arbeit der Selbsthilfegruppen und -organisationen wird immer professioneller. Das erfordert mehr Personal und kostet dadurch auch zunehmend mehr Geld", betonte Karin Niederbühl. Sie hatte im Auftrag der Ersatzkassen die Erstellung des Berichts betreut. Regionalgruppen haben meist keine Information über Pharma-Gelder In der Studie wird festgestellt, dass es die Geschäftsleitung der Selbsthilfeorganisationen ist, die darüber entscheidet, welche Pharmagelder angenommen und wofür sie verwendet werden. Die örtlichen Gruppenmitglieder sind darüber in den meisten Fällen nicht informiert. Es gebe allerdings auch Selbsthilfegruppen, die sich wegen der Beeinflussung durch die Industrie von größeren Verbänden abgespalten hätten. Ergebnisse im Bereich Psoriasis Untersucht wurden der "Deutsche Psoriasis Bund" (DPB) und die Psoriasis Selbsthilfe Arbeitsgemeinschaft" (PSOAG). Nicht untersucht wurden "Psoriasis & Haut " und die "Deutsche Rheuma-Liga" (für Psoriasis Arthritis). Beim DPB gibt es direkte und indirekte Auftritte der Pharmaindustrie in der Mitgliederzeitschrift "PSO Magazin". "Direkter Auftritt" heißt direkte Werbung, "indirekter Auftritt" heißt, es gab Publikationen über Pharmaprodukte. Die PSOAG hat keine Mitgliederzeitschrift. Auf der DPB-Internetseite gab es indirekte Auftritte der Pharmaindustrie und Links zur Pharmaindustrie bzw. Medizintechnik. Auf der PSOAG-Internetseite gibt es keine Hinweise auf Pharmafirmen. Beim DPB existiert ein wissenschaftlicher Beirat. Die dort vertretenen Ärzte und Wissenschaftler bekommen im Rahmen ihres Berufes von der Pharmaindustrie Sponsoring-Gelder. Die wurden nicht erkennbar deklariert, sondern erst auf Nachfrage bestätigt. Die PSOAG hat keinen wissenschaftlichen Beirat. Beide Organisationen haben eine Selbstverpflichtungserklärung abgegeben, in denen festgelegt wird, wie mit Wirtschaftsunternehmen umgegangen werden soll. Der DPB hatte folgende Leitsätze: http://www.psoriasisbund.de/Leitsaetze_des_Deutschen.465.0.html (Link funktioniert nicht mehr) Die Leitsätze der PSOAG waren abrufbar (die PSOAG gibt es inzwischen nicht mehr) Kritik an der Kritik Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) wies die Kritik zurück. BPI-Sprecher Wolfgang Straßmeir sagte, mit diesen pauschalen Vorwürfen werde den Patientenorganisationen Unmündigkeit und Unprofessionalität unterstellt. Hans-Detlef Kunz (DPB) erklärte auf der Pressekonferenz, für seinen Verband seien die Fakten falsch erhoben worden. So hätte es nie direkte Werbung für Pharmaprodukte in der "PSO-Magazin"-Ausgabe für Patienten gegeben, sondern nur in der für Ärzte. Die erwähnte Veranstaltung, auf der für Pharmaprodukte geworben wurde, sei eine wissenschaftliche Weiterbildung für Ärzte gewesen. Dr. Kirsten Schubert wies auf Nachfrage darauf hin, dass daran außerdem mehr als 40 DPB-Regionalgruppenleiter – also Patienten – teilgenommen hatten. Bei der Pressekonferenz waren auch Pharmavertreter anwesend. Einige erklärten, dass sie noch nie versucht hätten, inhaltliche Aussagen der Patientenvertreter zu beeinflussen. Im Gegenteil gebe es einen sachlichen Dialog und ein verständnisvolles Miteinander. Es sei "weltfremd", zu fordern, dass nur solche Ärzte in wissenschaftlichen Beiräten von Patienten-Organisationen mitmachen dürften, die keine Pharmagelder bekämen. Jeder anerkannte Experte arbeite heutzutage mit der Industrie zusammen. Lösungsvorschläge Aus Sicht der Sozialwissenschaftler sollte eine unabhängige Beratungs- und Kontrollstelle geschaffen werden. Nur so könne man unerwünschte Einflüsse auf die Selbsthilfe eindämmen. Eine solche Einrichtung sollte vom Staat und der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden. Zudem sollten alle Selbsthilfeorganisationen eine Selbstverpflichtung abgeben, um mehr Unabhängigkeit von Pharmaunternehmen zu erzielen. Der Vorstandsvorsitzende der Kaufmännischen Krankenkasse, Ingo Kailuweit, meinte, weiteres Sponsoring durch die Pharmaindustrie sei nicht notwendig. Die Krankenkassen würden künftig mehr Selbsthilfeförderung zahlen. Die Krankenkassen sind schon jetzt gesetzlich verpflichtet, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeverbände finanziell zu fördern. Zukünftig würden dafür pro Mitglied und pro Jahr 55 Cent bereitstehen. Zuvor waren es nach Angaben von Kailuweit im Durchschnitt rund 25 Prozent weniger. Wer sind die Untersuchenden? Das Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) ist ein Forschungsinstitut der Universität Bremen und wurde Ende 1988 nach eigenen Angaben als erstes interdisziplinäres Sozialpolitik-Institut in Deutschland gegründet. Es wird von der Universität und vom Land Bremen getragen. Professor Glaeske ist Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Quellen: Schilling, R. (2006): Die Entwicklung der Arbeits- und Fördersituation von Bundesvereinigungen der Selbsthilfe in Deutschland - ein zeitlicher Vergleich von Erhebungen der NAKOS zu den Jahren 1997, 2001, 2002 und 2004. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (Hrsg.) Selbsthilfegruppenjahrbuch 2006 Werkstattbericht zur Entwicklung und Förderung des internen Diskurses zwischen Krankenkassen und Selbsthilfegruppen "Einfluss des pharmazeutisch-industriellen Komplexes auf die Selbsthilfe", Dr. Kirsten Schubert, Professor Gerd Glaeske, Universität Bremen - Zentrum für Sozialpolitik Berichte der Nachrichtenagenturen AP, dpa Mehr zum Thema Patient gesucht (Die Zeit, 14.12.2006) Pharmakonzerne entdecken Selbsthilfeorganisationen als lukrativen Vertriebsweg "Pharmamarketing: Wir sind doch kein Caritasverein" (gesundheitsblog.de, 30.11.2006) nicht mehr online Ist Selbsthilfe käuflich? (Blog "bedarfshaltestelle", 18.12.2006) nicht mehr online Patientenverbände und Pharmaindustrie (Blog "Stationäre Aufnahme") hier und hier-
- Korruption
- Pharmaindustrie
- (und 3 mehr)
-
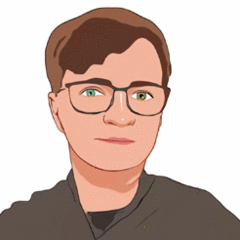
Lesen, Hören, Sehen: Tipps zum Wochenende – Ausgabe 3/24
Claudia Liebram erstellte ein Artikel in Magazin
Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit, sich um die Gesundheit zu kümmern! Alle zwei Wochen geben wir hier Tipps, welche Artikel, Videos oder Audios für Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis interessant sein könnten. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und manchmal auch Unterhaltung! Behandlungsmöglichkeiten bei Psoriasis (SWR/ARD GESUND, 08:06 Minuten) Wer die Diagnose Schuppenflechte noch nicht lange hat, ist vielleicht auf der Suche nach einer Übersicht: In diesem Video wird anhand des Beispiels von einem Betroffenen erläutert, wie die Krankheit verläuft, welche Symptome auftreten und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Wie Gesundheits-Tipps in der Illustrierten "Bunte" entstehen (Übermedien) Ihr lest gerne Illustrierte, und sei es nur beim Arzt oder Friseur? Artikel zum Thema Gesundheit findet Ihr immer interessant? Dann habt spätestens ab jetzt im Hinterkopf, wie dort Werbung dahergeschlichen kommt und die Redakteure sich Arbeit ersparen. Zum Beispiel so: Eine Pharma-Firma lädt zur Pressekonferenz und hat da ein Interview vorbereitet – also PR-Material. Wer bietet das als eigenes Interview an? Richtig: die Bunte. Ruf der Pharmaindustrie bei Patienten so naja (Healthcare Marketing) Jedes Jahr werden Patientenorganisationen befragt, wie sie den Ruf der Pharmaindustrie einschätzen. Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen PatientView hat die Ergebnisse der Befragung aus dem Jahr 2023 veröffentlicht. Sagen wir mal so: Der Ruf war schon mal besser. Wie Angehörige gut mit Kranken sprechen – und ihnen so sogar helfen (Visite, 7 Minuten) Ihr habt eine schwere Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis und wollt von Angehörigen verstanden werden? Dann zeigt ihnen diesen Beitrag. Oder andersherum: Jemand in Eurem Umfeld ist schwer krank und Ihr wisst nicht, wie Ihr mit ihm und seiner Krankheit gut umgehen könnt? Dann schaut Euch das Gespräch mit einer Psychotherapeutin an. Wollt Ihr keine Hör- und Gucktipps verpassen? Dann klickt oben auf "abonnieren". Ihr erhaltet dann bei jedem neuen Beitrag eine Benachrichtigung.-
- Pharmaindustrie
- Psychologie
-
(und 3 mehr)
Markiert mit:
-
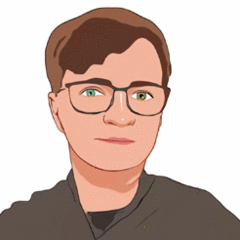
Lesen, Hören, Sehen: Tipps zum Wochenende – Ausgabe 2/24
Claudia Liebram erstellte ein Artikel in Magazin
Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit, sich um die Gesundheit zu kümmern! Alle zwei Wochen geben wir hier Tipps, welche Artikel, Videos oder Audios für Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis interessant sein könnten. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und manchmal auch Unterhaltung! Die Macht der Pharma-Firmen (Terra X Harald Lesch) Pharmafirmen sparen bei Ankündigungen oft nicht mit Superlativen: Neue, bahnbrechende Behandlungsmethoden sollen die schlimmsten Krankheiten der Menschheit besiegen. Doch was steckt wirklich hinter den Versprechen der Arzneimittelkonzerne? Steht das Wohl der Patienten im Vordergrund oder geht es am Ende doch nur um den Gewinn? Harald Lesch nimmt die Pharmabranche genau unter die Lupe und hinterfragt ihre Motive. Dabei geht es auch um die teuren Medikamente, wie sie die Biologika bei Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis auch sind. Und wer schon immer mal Harald Lesch mit Hut in eine Apotheke gehen oder mit dem Taxi durch Berlin fahren sehen wollte – bitteschön. Gesundheitsmärchen, ansprechend erzählt (taz) Manche Influencer nutzen Instagram, um medizinisches Wissen zu vermitteln. Allerdings sind nicht nur die geteilten Informationen manchmal unzutreffend, sondern es gibt noch weitere Probleme. Einige vermengen auch kräftig Informationen, Werbung und Verkauf – und kleben sich schon mal ein "Doc" in die Bezeichnung, obwohl sie noch keine Ärzte sind (und das auch nicht werden sollten, wie einige meinen). Psoriasis-Grundwissen in zwei Teilen (Podcast "Hautgeschichten") Beim Podcast "Hautgeschichten" erzählen Dr. Ruo-Xi Yu und Dr. Johanna Meinhard alle zwei Wochen etwas über die Haut und zwangsläufig auch über deren Erkrankungen. In zwei Folgen widmeten sich sich jetzt der Schuppenflechte. Jede Folge ist etwa eine halbe Stunde lang. In Teil 1 geht es um die Diagnose, Auslöser, Symptome, Begleiterkrankungen, Differenzialdiagnosen und äußerliche Therapien. Teil 2 dreht sich um innerliche Therapien und Impfungen. Das Immunsystem – was ist das eigentlich? (Apotheken-Umschau) Das Immunsystem – das ist doch dieses Netzwerk aus Zellen, Geweben und Organen, das uns vor Krankheitserregern wie Viren, Bakterien und Pilzen schützt. Ja klar, aber wie funktioniert es? Die Apotheken-Umschau erklärt das in Wort und Bild. Wollt Ihr keine Hör- und Gucktipps verpassen? Dann klickt oben auf "abonnieren". Ihr erhaltet dann bei jedem neuen Beitrag eine Benachrichtigung.-
- 1
-

-
- Immunsystem
- Pharmaindustrie
-
(und 2 mehr)
Markiert mit:
-
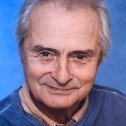
Eli Lilly baut eine Fabrik – und das hier ist für den Hinterkopf
Rolf Blaga erstellte ein Artikel in Magazin
Es kommt selten vor, aber diesmal hat es eine Wirtschaftsnachricht ins Psoriasis-Netz geschafft: Eli Lilly wird in Zukunft „injizierende“ Medikamente auch in Deutschland produzieren. Eine gute Meldung für deutsche Arbeitsplätze! Bemerkenswert auch deshalb, weil große Pharmafirmen immer wieder damit drohen, Produktionsstätten in andere Länder zu verlagern. Sie begründen das vor allem damit, dass Innovationen in Deutschland durch Bürokratie behindert werden würden (siehe Spesolimab). Außerdem würden ihre Preise unterlaufen werden, weil sie durch das GKV-Stabilisierungsgesetz um fünf Prozent gekürzt werden sollen. Lilly gehört nicht zu den Klägern gegen das Gesetz, teilt aber die Kritik daran. Sachlich ist festzustellen: Hochpreisige Medikamente wie Taltz sind nie in Niedriglohnländern hergestellt worden, sondern immer schon in Europa, Nordamerika oder Japan. In dieser Preisklasse riskiert man keine Lieferengpässe. Die Produktion der Firma muss erweitert werden. Vor allem wegen des erwarteten Ansturms auf die so genannte "Abnehmspritze" Mounjaro. Aber auch der Umsatz von Taltz außerhalb der USA steigt steil an. Zwischen 2020 zu 2022 um über 25 Prozent von 500 Millionen US-Dollar auf 757,4 Millionen US-Dollar. Dieser Trend hält an, wie die bisher für 2023 veröffentlichten Quartalszahlen zeigen. Der Rechtsstreit mit Novartis wegen Patentverletzungen wurde 2022 außergerichtlich geklärt. Damit ist abgesichert, dass bei Taltz weiterhin auf dem Markt bleiben darf. Eli Lilly steht inzwischen auf dem ersten Platz einer Prognose, welche Firma von 2023 bis 2028 Marktführer bei Psoriasis-Medikamenten sein werden. Was gerne verdrängt wird: Großen Pharmafirmen, die auch Psoriasis-Biologika herstellen, wurden in den USA illegale Methoden mit teilweise schwerwiegenden Folgen nachgewiesen. Bei manchen liegt es länger zurück, andere sind Wiederholungstäter bis in die heutige Zeit (Opioide). Über Eli Lilly zum Beispiel ist bekannt, dass Informationen über schwere bis hin zu tödlichen Nebenwirkungen bei Psychopharmaka verschwiegen oder heruntergespielt wurden. Außerdem wurden Ärzte bestochen Medikamente zu verschreiben, obwohl die für die jeweiligen Krankheiten nicht zugelassen waren. Eli Lilly musste in 28.500 Fällen Betroffene entschädigen. Das war zwischen 2005 und 2009. Heutzutage müssen alle Beteiligten sehr genau hinsehen, was rund um die als "Abnehmspritze" hochgejubelten Medikamente Mounjaro (Eli Lilly) und Wegovy bzw. Ozempic (Novo Nordisk) passiert. Erste "umstrittene Werbemethoden" von Novo Nordisk sind bereits bekanntgeworden. -
In der Schweiz sind Plakate der Firma AbbVie von der Aufsichtsbehörde beanstandet worden. Darauf wurde ganz allgemein für Biologika und für das Patientenbetreuungsprogramm geworben. Auf dem Plakat stand: Ein QR-Code führte zu einer Internetseite, auf der die Schuppenflechte im Allgemeinen und Biologika im Besonderen erklärt wurden und Adressen von Hautärzten zu finden waren. Die schweizerische Aufsichtsbehörde Swissmedic, vergleichbar mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland, fand das alles zu nah dran am Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente. Das gleiche Verbot gilt auch in Deutschland. Deshalb bleiben derartige Anzeigen auch hierzulande recht allgemein. Da wird dann "nur" versprochen, dass die Psoriasis vergessen werden kann, wenn man "innovative Medikamente" oder "moderne Medikamente" nimmt. Es wäre auch in Deutschland neu, wenn Werbung beanstandet wird, die halbwegs allgemein für eine Art von Medikamenten wirbt. Das macht im Bereich der Psoriasis zum Beispiel die Firma Janssen so im Mitgliedermagazin des Deutschen Psoriasis-Bundes – und nochmal: Es ist erlaubt. In diesem Artikel wird der Vorgang um AbbVie in der Schweiz erklärt. Die Plakatkampagne pausiert nun. Die Firma will die Sache erst einmal mit SwissMedic klären. AbbVie ist Hersteller unter anderem der Medikamente Humira und Skyrizi.
-
Apps speziell für Menschen mit Schuppenflechte waren bisher nicht sonderlich langlebig. Jetzt reiht sich "Orya" leider ein. App „Orya“ von Temedica „Orya“ ist eine App, mit der Menschen mit Schuppenflechte ihre Krankheit und deren Verlauf besser verstehen sollten – und mit deren Hilfe klarer werden sollte, welche Einflussfaktoren es gibt. Das Ziel: die Betroffenen sollten ihrer Therapie länger treu bleiben, die Behandlungsergebnisse sollten langfristig besser werden. Nutzer konnten Gesundheits- und Krankheits-Verlaufsdaten eingeben. Es gab eine Exportfunktion, damit diese Daten bei den gemeinsamen Entscheidungen mit dem Arzt helfen sollten. Entwickelt wurde die App von der Firma Temedica. Kooperationspartner für die Psoriasis-App – also Geldgeber – war die Pharmafirma Bristol Myers Squibb. Die hat ein Medikament gegen Schuppenflechte auf dem Markt: Deucravacitinib, eine Tablette, die am Ende die Interleukine IL-12 und IL-23 sowie zusätzlich die vom Typ-1-Interferon bändigt. Wem das bekannt vorkommt: IL-12 und IL-23 sind „beliebte“ Angriffsziele der Biologika, die seit Jahren gegen Schuppenflechte und Psoriasis arthritis zum Einsatz kommen, aber als Injektionen daherkommen. An der Entwicklung der App waren immer wieder Betroffene beteiligt. Jeder konnte sich als Tester „bewerben“ und wurde an einigen Stellen im Entwicklungsprozess um seine Meinung gebeten. Mal ging es darum, welche Funktionen gebraucht werden, mal darum, welche Formulierungen gebräuchlicher oder besser verständlich sind. Auch mit einem Instagram-Account wurde der Kontakt zu Betroffenen gepflegt. Temedica, die Firma hinter der App, ist in Sachen Gesundheits-Apps absoluter Profi. Gründerin Gloria Seibert ist schon ewig auf den eHealth-Panels dieser Republik zuhause. Sie kennt alle Schwierigkeiten rund um die Entwicklung und Zulassung solcher Apps in einem Markt, der umkämpft und stark reguliert ist. Temedica hat Erfahrung mit Apps zur Begleitung bei Beckenboden-Problemen, Adipositas und Diabetes, Multipler Sklerose und Morbus Bechterew. Andere Apps dienen der Betreuung von Patienten in Studien. „Durch die direkte und langfristige Interaktion mit Patienten gewinnt Temedica einzigartige und bislang unbekannte Einsichten und Real-World Evidence zu Krankheitsverläufen und zur individuellen Wirksamkeit von Therapien“, heißt es in der Selbstdarstellung der Firma in einer Mitteilung. „Temedica ist Experte für personalisierte Patienten-Unterstützung und für Erfassung, Strukturierung und Analyse von Gesundheitsdaten.“ Womit dann auch klar ist, wie Temedica sein Geld verdient: mit dem Verkaufen dieser Daten. Versprochen werden „einzigartige Einblicke entlang der gesamten Patient Journey und der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen“. Sprich: Temedica weiß dank der Daten, wie oder womit man Patienten in jeder Phase ihrer Erkrankung und ihres Lebens so ansprechen kann, dass sie der Pharmafirma oder jedem anderen Käufer der Daten treu bleiben – oder noch bessere Kunden werden. Die App "Orya" wird zum 1. Januar 2024 eingestellt. Die Daten werden danach komplett gelöscht. "Wir hoffen, das Thema Psoriasis weiter zu bearbeiten", schrieb der Anbieter in einer Abschiedsmail. Ein anderer Weg: "MyTherapy" Einen etwas anderen Weg geht der App-Anbieter smartpatient. Dessen App „MyTherapy“ gibt es schon ewig. Sie ist nicht auf bestimmte Krankheiten spezialisiert. Das wird auch so bleiben, doch künftig werden einige Erweiterungen angeboten. Eine für Patienten mit Multipler Sklerose wird gerade in einer Studie untersucht. Eine Version „myTherapy für Psoriasis“ gibt es bereits. Sie ist ebenso kostenlos. Dazu kommt für alle, die das Medikament Cosentyx nutzen, eine weiteres Zusatzangebot. Solche Zusatzangebote werden als Module zum Beispiel an Pharmafirmen verkauft. Inhalte wie Medikamenten-Erinnerungen, Videos, Artikel oder Bilder können von den Firmen direkt an Patienten gebracht werden, die ein Medikament oder anderes Produkt der zahlenden Firma anwenden. Dazu muss der Patient – wie bei allen Patientenbetreuungsprogrammen – nachweisen, dass er wirklich das Medikament verwendet. Der Vorteil der App MyTherapy ist ihr übergreifender Ansatz: Viele Menschen mit Psoriasis haben auch andere Krankheiten. Die Behandlung, Medikamenten-Erinnerungen usw. in einer einzigen App zu organisieren, ist auf lange Sicht vielleicht alltagstauglicher. Bleibt aber auch hier: Der Nutzer ist mit seinen Daten Teil des Geschäftsmodells. Lange allein: "Sorea Helferin" Eine weitere App zur Begleitung von Menschen mit Psoriasis im Alltag speziell in Deutschland ist „Sorea Helferin“. Eine Basisversion ist kostenlos. Krankenkassen oder die Nutzer selbst zahlen für weitergehende Funktionen. Die Anbieter-Firma Nia Health zählt zu ihren Partnern aber auch Pharmafirmen wie Leo Pharma, Pfizer oder Sanofi Genzyme. Noch frisch: Care+ Von der Firma Biogen kommt die App "Care+" für Menschen mit Gelenk-, Darm und Hauterkrankungen. Biogen ist Hersteller des Medikaments Fumaderm, aber vor allem von Biosimilars, also Nachbauten von Biologika. In der App wird über diese Art Medikamente informiert und jeder Nutzer kann seinen Gesundheitszustand protokollieren. Abgefragt wird dafür zum Beispiel ein ganz allgemeiner Gemütszustand ("Wie fühlen Sie sich heute?") oder die aktuelle Schwere der Psoriasis. Im Laufe der Zeit entsteht ein Verlauf. Vielleicht lässt sich daraus ja erkennen, dass die Schuppenflechte immer im Frühjahr oder immer im Herbst schlimmer wird. In einem anderen Teil der App gibt es Informationen zum Alltag, der Arbeit, über Sport oder Ernährung. Eine Erinnerung an die nächste Medikamenten-Anwendung kommt ebenfalls aufs Handy. Ganz fehlerfrei ist die App nicht: So wird zum Beispiel ein Rechner für die Körperoberfläche angeboten – mit der Erläuterung "Mit diesem ... Rechner können Sie berechnen, wie viel Hautoberfläche von der Psoriasis-Arthritis betroffen ist." Die Psoriasis arthritis spielt sich aber eben nicht auf der Hautoberfläche ab. Andere Apps: verschwunden Alle anderen derartigen Psoriasis-Apps sind nach und nach aus den AppStores verschwunden. Wer sich ein Bild von ihren Funktionen machen will, kann dies bei uns tun: mit Screenshots der „My Psoriasis App“ von Leo Pharma und von der „PsoriApp“, die von Novartis kam.
-
Pharmafirmen schweigen zu Herstellungsbedingungen (Stiftung Warentest, 20.07.2022) Bei Bekleidung wurde schon mancher Skandal durchs mediale Dorf gejagt, wenn es um die Herstellungsbedingungen in Fernost geht. Aber bei Medikamenten – erinnert sich jemand? Stiftung Warentest hat bei zehn mittleren und großen Herstellern nachgefragt – eigentlich "harmlose" Dinge.:Woher beziehen sie die Wirkstoffe für ihre Medikamente? Wie stellen sie sicher, dass Qualität, Arbeits- und Umweltbedingungen in Fernost stimmen? In anderen Branchen kramt bei solchen Fragen irgendjemand in der Firma die Textbausteine aus der Qualitätssicherung, dem Marketing oder der GMP-Abteilung ("Good Manufacturing Practice" oder zu deutsch "Gute Herstellungspraxis") zusammen und schickt sie als umfassende Antwort. Nicht so bei Pharma offensichtlich. Nur vier der zehn befragten Firmen zeigten sich kooperativ, und das noch nicht mal überschwänglich. Der Artikel lässt sich auch als PDF herunterladen. Pharmaindustrie entdeckt für ihr Marketing die Influencer (basic thinking, 27.3.2019) Im Urgestein deutschsprachiger Blogs wurde jetzt ein Thema aufgegriffen, das wir auch schon länger beobachten: Patienten, die in sozialen Medien erzählen, wie toll eine Therapie ist oder wie easy doch das Leben mit Schuppenflechte sein kann. Was wir so dazu denken, haben wir dort in einem länglichen Kommentar hinterlassen. Krankheit als Geschäft (Süddeutsche Zeitung, 9.1.2019) Zwei Bücher über den Einfluss der Pharmaindustrie vorgestellt (Blog "Patientensicht", 29.11.2013) Im schweizerischen Blog "Patientensicht" werden die zwei derzeit wichtigsten Bücher über den Einfluss der Pharmaindustrie auf die Gesellschaft vor- und gegenübergestellt: "Deadly Medicines and Organised Crime“ von Peter Gøtzsche und "Bad Pharma" von Ben Goldacre. Letzteres ist bereits auf Deutsch erschienen, ersteres bislang nicht. Im Blog-Beitrag kann man also auf einen Schlag zwei Bücher kennenlernen. Was an Zahlungen von Pharmafirmen an Ärzte das Problem ist (Correctiv, 26.07.2016) Mehrere Medien veröffentlichten im Jahr 2016 eine Datenbank. Aus der konnte jeder entnehmen, ob (s)ein Arzt von Pharma-Firmen Geld oder Geschenke bekommen hat. Nach der Veröffentlichung fragten viele Leser: Was ist denn schlimm daran, wenn ein Arzt ein paar Hundert Euro zusätzlich bekommt? Hier ist die Antwort. Deutschlands ehemals oberster Therapie-Wächter schaut zurück (Spiegel online, 19.08.2013) Peter Sawicki musste im Jahr 2010 den Posten des Chefs von Deutschlands wichtigstem Gesundheits-Institut IQWIG räumen. Spiegel online hat gefragt, was er jetzt macht - und nach seiner Sicht der Dinge in Sachen Pharmaindustrie und Gesundheitswesen. Klingt resigniert, aber Sawicki neigt auch nicht zu Pauschalurteilen: Schleichwerbung, schlecht versteckt in bunten Blättern (topfvollgold, 21.07.2013) Die Schreiber dieses wundervollen Blogs haben ein eher traurigen Fazit aus 100 Tagen Beobachtung der Regenbogenpresse gezogen: Es geht u.a. darum, wie für tolle Mittel aller Art geworben wird, z.B. für einen Nagellack - und das nicht einfach mit einer Anzeige, sondern mit nicht mal gut versteckten Texten im redaktionellen Teil. Wie Schweizer Pharmafirmen DDR-Patienten ausnutzten (Der Beobachter, 28.06.2013) Die Pillentests der Schweizer Pharma im Unrechtsstaat DDR waren umfangreicher als bekannt. Patienten wussten von nichts, Todesfälle wurden verschwiegen. Viele neue Medikamente ohne größeren Zusatznutzen (Süddeutsche Zeitung, 10.05.2013) Pharmaindustrie soll Leitlinien beeinflusst haben (Spiegel online, 24.03.2013) Die Ersteller der erwähnten Psoriasis-Leitlinie aus dem Jahr 2006 haben ihre Sicht der Dinge später in einer Stellungnahme an das Deutsche Ärzteblatt veröffentlicht. Griechenland macht deutsche Pillen billig (Spiegel online, 08.03.2012) Wenn entschieden wird, was ein neues Medikament kosten darf, sollen ab sofort auch die Preise anderer EU-Länder zum Vergleich gezogen werden. Für die Pharmafirmen kann das Umsatzeinbußen bedeuten. Für Patienten ist das wichtig, weil damit zum Beispiel teure Biologika günstiger werden könnten. Fehlende Transparenz (taz, 03.06.2010) Zunehmend verlangen Fachzeitschriften, dass ihre Autoren offenlegen, ob geschäftliche Verbindungen zu Pharmafirmen bestehen.
-
Im November 2014 erschien das Buch "Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität – Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert" des dänischen Medizinforschers Peter C. Gøtzsche auf Deutsch. Schon bei seinem Erscheinen ein Jahr zuvor auf Englisch hat es weltweit Furore gemacht und ist als grandiose Radikal-Kritik an den global agierenden Pharmakonzernen gelobt worden. Gøtzsche behauptet, dass nahezu alle großen Pharmafirmen ihre Medikamente mit Methoden vertreiben, die mehr oder weniger „kriminell“ seien. Tausende Patienten wären gestorben oder hätten schwere Schäden erlitten, weil die Firmen verhindert haben, dass negative Wirkungen eines Medikaments bekannt wurden. Der Autor warnt davor, Informationen über Medikamente unkritisch zu übernehmen. Die Pharmaindustrie setze mit enorm viel Geld und ohne Skrupel ihre Marketing-Interessen auf allen Ebenen durch. Er rät Patienten, mit Medikamenten sehr vorsichtig umzugehen und sie abzusetzen, wenn sie einem zu riskant erscheinen. Gøtzsche ist kein Anhänger einer Alternativ-Medizin. Er fordert für die gesamte Schulmedizin unabhängige, industrie-ferne Experten und Studien. Sein Standpunkt ist eindeutig: Er glaube der Pharmaindustrie nicht, weil sie die Öffentlichkeit wiederholt belogen habe – selbst wenn sie manchmal die Wahrheit sage. Pharmakonzerne begehen Straftaten Als Patient würde man sich wünschen, Gøtzsche wäre ein klassischer „Verschwörungstheoretiker“. Dann könnte man, was er behauptet, als völlig überzogenen Generalverdacht zurückweisen: Die internationalen Pharmakonzerne würden Straftaten begehen, wie man sie von der Mafia und vergleichbaren kriminellen Organisationen kenne und seien verantwortlich für zehntausende Tote. Die vielen Fälle, über die er ausführlich berichtet, sind aber genauso passiert und werden von ihm akribisch belegt. Keinem Pharma-Anwalt ist es gelungen, sein Buch juristisch zu verhindern. Was noch erschreckender ist: Trotz veröffentlichter Skandale, Gerichtsurteile, Vergleiche, Strafgelder, Schadensersatz und Abfindungen in Milliardenhöhe wären das keine Einzelfälle geblieben. Die Zahl der Straftaten nehme weiterhin schnell zu. In den USA würden Pharmariesen dreimal so viele schwere oder mittelschwere Gesetzesverstöße begehen wie andere Unternehmen. Medikamente sind dritthäufigste Todesursache Fast jede Berufsgruppe, die für die Pharmaindustrie von Bedeutung sei, werde mit großen Geldbeträgen bestochen. Kriminalität, Korruption und unzulängliche Überwachung von Medikamenten seien gängige Praxis. Die wissenschaftliche Literatur über Medikamente werde systematisch verfälscht. Manager der Pharmaindustrie würden Ärzte, Patienten, Behörden und Gerichte belügen. Anstelle von unabhängigen Experten bestimmten Pharmakonzerne, was wir von Medikamenten halten sollen. Das erklärt, so Gøtzsche, weshalb Medikamente in den Vereinigten Staaten und in Europa (nach Herzkrankheiten und Krebs) die dritthäufigste Todesursache seien. Das Buch ist derart umfassend, dass es an dieser Stelle nicht vollständig gewürdigt werden kann. Aber es ist so eindrucksvoll, dass „mündige Patienten“ es unbedingt lesen sollten. Zumal es nicht nur sehr verständlich geschrieben ist, sondern auch streckenweise spannend. Diese Buchbesprechung konzentriert sich auf die Aussagen, die uns Psoriatiker interessieren könnten. Pharmahersteller mussten Milliarden Beträge zahlen Der Autor schildert Fälle u.a. von Abbott (AbbVie), Janssen (Janssen-Cilag), Merck (MSD), Novartis und Wyeth (Pfizer) – alles Firmen, die auch Biologika für Psoriasis und Psoriasis arthritis auf den Markt gebracht haben. Sie mussten allein in den USA Strafen zwischen 95 Millionen und 3 Milliarden Dollar zahlen. Die häufigsten Straftaten waren illegale Vermarktung (Ärzten wurde empfohlen, die Medikamente für nicht zugelassene Indikationen zu verwenden) falsche Darstellung von Forschungsergebnissen durch bezahlte Autoren Verschweigen oder Vertuschen schädlicher Wirkungen von Medikamenten Bestechung von Ärzten und Beamten bis hin zu Rabatt-Betrug an öffentlichen Gesundheitsdiensten In 2012 musste z.B. die Firma Amgen 762 Millionen Dollar zahlen, weil sie in den USA u.a. Enbrel® für die leichte Psoriasis propagiert und Ärzten Schmiergelder bezahlt hatte. Dramatisch war der Fall Vioxx, ein nicht-sterioales Anti-Rheumamittel (NSAR) zur Behandlung von Gelenkerkrankungen wie der Psoriasis arthritis. Das Medikament wurde von Merck (MSD) auf den Markt gebracht. Gøtzsche beschreibt, dass es von Anfang an bekannt gewesen sei, dass COX-2-Hemmer das Thrombose-Risiko erhöhen. Kritische Wissenschaftler und Journalisten, die immer wieder darauf hinwiesen, wurden von der Firma systematisch verfolgt, beruflich diffamiert und persönlich bedroht. Das Unternehmen verpflichtete medizinische „Meinungsmacher“ für viel Geld, positive Aussagen zu Vioxx® abzugeben. Merk habe, so der Autor, mit Vioxx® ungefähr 120.000 Patienten durch Thrombosen umgebracht. Viele von ihnen hätten gar nicht mit dem Mittel behandelt werden müssen. Paracetamol hätte die gleiche Wirkung gehabt. Die Firma wurde wegen Betrugs bei der Vermarktung von Vioxx® verurteilt. So zahlte Merck z.B. 2007 in einem Vergleich 4,85 Milliarden Dollar, der ohne die zusätzlichen 1,2 Milliarden Dollar an Anwaltskosten vermutlich noch höher ausgefallen wäre. In 2012 musste die Firma noch einmal als Geldstrafe und Schadenersatz fast 1 Milliarde Dollar zahlen. Die Geschichte der NSAR sei, so Gøtzsche, „eine Horror-Story voller übertriebener, unlogischer oder falscher Behauptungen, Gesetzesverstöße, untätiger Behörden und Nachgiebigkeit gegenüber der Industrie." Mehrere dieser Medikamente mussten vom Markt genommen werden. Die Behauptung, NSAR besäßen eine entzündungshemmende Wirkung sei ein Schwindel. Konkret benennt er z.B. Naproxen, Piroxicam und Benoxprofen und macht Pfizer und Eli Lilly für den Tod hunderter Patienten verantwortlich. Auch bei der bei der Celecoxib-Studie von Pfizer wäre betrogen und gelogen worden. Trotzdem werden NSAR weiter zur Behandlung der Psoriasis arthritis eingesetzt. Pharmaindustrie honoriert Ärzte und Wissenschaftler Pharmaunternehmen würden nie über Vor- und Nachteile ihrer Medikamente sprechen, sondern nur darüber, wie wirksam und ungefährlich sie seien. Als Beleg beriefen sie sich auf Studien, die sie selbst finanziert, vorstrukturiert und ausgewertet hätten. Sie würden Ärzten und Wissenschaftlern extrem hohe Honorare zahlen, nicht selten bar. Gøtzsche stellt fest, dass die meisten Experten eines Fachgebiets auch für die Pharmaindustrie arbeiten. In Dänemark, wo das genehmigt werden muss, haben 39 % der Dermatologen die Erlaubnis, für die Pharmaindustrie zu arbeiten. Damit gäbe es im ärztlichen und im wissenschaftlichen Bereich keine gegenseitige Kontrolle unter Kollegen mehr. Unabhängige Studien gäbe es immer seltener. Sie würden von den Pharmafirmen sabotiert, z.B. indem keine Placebos zur Verfügung gestellt werden. Gøtzsche fordert Gesetze, die eine unabhängige Forschung ermöglichen. Klinische Studien müssten als öffentliche Aufgabe durchgeführt werden. Die Pharmaindustrie, die gegenwärtig erheblich von staatlich finanzierten Universitäten und dem öffentlichen Gesundheitswesen profitiert, könnte das über Steuern mittragen. Der Autor stellt fest, dass die meisten Mitglieder in beratenden Ausschüssen keine „unabhängigen Experten“ seien. Er weist darauf hin, dass in allen Arzneimittel- oder Leitlinien-Ausschüssen und in Wissenschaftlichen Beiräten Ärzte mit finanziellen Verbindungen zu Pharma-Unternehmen sitzen. Selbst wenn „Interessenkonflikte“ offengelegt werden, sei es fraglich, ob sich ein hoch dotierter Berater der Pharmahersteller stets neutral nur von Daten leiten lasse. Das widerspräche der inzwischen weit verbreiteten Kultur der unbegrenzten Gier und des Betrügens. Bei Vorträgen, so Gøtzsche, würden Ärzte Folien zeigen, die offenkundig nicht sie, sondern Pharmaunternehmen vorbereitet hätten. Das kennen wir z.B. von den „Psoriasis-Gesprächen“. Hautärzte laden ihre Patienten ein, um über Schuppenflechte zu referieren. Mal wird der Sponsor gar nicht erwähnt, mal wird der Firma AbbVie allgemein für die Unterstützung gedankt – ohne aber dass die Zuhörer erfahren, was genau die Firma mit Psoriasis zu tun hat. Wir haben nie erlebt, dass die Patienten darüber informiert werden, der Arzt würde jetzt eine vorgegebene Präsentation der Firma AbbVie vortragen. Widerspruch nicht willkommen Wie schwierig es ist, wissenschaftlich Klarheit über ein Medikament zu bekommen, zeigt sich z.B. bei Fumaderm®: Die unabhängigen Mediziner des arznei-telegramms kritisieren das Medikament immer wieder. Sie weisen z.B. auf die unzulängliche Studienlage hin und bemängelten, dass Aufsichtsbehörden viel zu langsam auf die bekannt gewordenen drei Todesfälle reagiert hätten. Der Hersteller Biogen-Idec erklärte seinerzeit, diese Patienten hätten aufgrund ihrer Blutwerte nicht weiter mit Fumaderm behandelt werden dürfen. Die Firma wies darauf hin, dass es bei jetzt fast 200.000 Patientenjahren keine schweren Nebenwirkungen durch Fumaderm® gegeben hätte. Zweifel und Unsicherheit bleiben, weil es keine klärende wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen den unabhängigen Medizinern und den Experten der Pharmafirma gibt. Das bestätigt Gøtzsche, der darauf verweist, dass Widerspruch bei Pharmafirmen nicht willkommen sei. So etwas störe die Geschäfte. Mondpreise der Pharmaindustrie Um den Absatz ihrer Medikamente zu steigern, würden Pharmafirmen Statistiken vorlegen um zu beweisen, dass bestimmte Krankheiten nicht optimal behandelt werden würden. Sie warnen folglich vor einer „Unterbehandlung“. Versorgungsforschung gibt es inzwischen auch bei der Psoriasis. Nicht ganz unerwartet wird seit einigen Jahren verkündet, Psoriasis-Patienten seien unterversorgt. Deutlich kritisiert der Autor die „Mondpreise“ von aktuellen Medikamenten. So sei die Behandlung eines Rheuma-Patienten mit einem Biologikum in Dänemark 120-mal teurer als eine Therapie mit einem konventionellen Mittel. Begründet würden die Preise mit den immensen Forschungsausgaben der Firmen. Tatsächlich aber sei immer wieder nachgewiesen, so Gøtzsche, dass diese völlig überhöht angesetzt werden. Die Ausgaben für Marketing seien doppelt so hoch und Preisabsprachen wären in dieser Branche üblich. Wenn neue Medikamente so gut wären, wie die Pharmaindustrie uns weismachen wolle, wäre es kaum nötig, sie zu pushen und Ärzte zu bestechen, damit sie die Präparate verschreiben. Bezahlen müssen diese exorbitanten Preise die Patienten, die Steuerzahler bzw. die Versicherten der Krankenkassen. Für Gøtzsche ist das „Diebstahl“. Pharmaunternehmen, die solche Preise verlangen, würden sich wie Straßengangster verhalten, denen man schutzlos ausgeliefert sei. Wertung Es fällt schwer, sich der Argumentation von Gøtzsche zu entziehen. Die Vorwürfe sind seriös recherchiert. Seine Schlussfolgerung, die Straftaten von Pharmafirmen seien kriminell, weil sie immer wieder vorkommen und Strafen oder Schadensersatz quasi aus der Portokasse finanziert werden, sind nachvollziehbar. Die unglaublich vielen Todesfälle durch Arzneimittel sind ebenfalls dokumentiert und machen Patienten am meisten Angst. Die positive Wirkung von Psoriasis-Medikamenten ist objektiv nachzuweisen. Man kann messen, wie sich die Plaques zurückentwickeln – klassischerweise mit dem PASI. Todesfälle gab es bei dem Biologikum Raptiva, das daraufhin sofort vom Hersteller Serono (heute Merck-Serono) vom Markt genommen wurde. Schwerwiegende Nebenwirkungen der Biologika sind bei rund 1 Prozent der Patienten möglich. Sie sollen im Register für Psoriasis und im Register für Psoriasis Arthritis gemeldet werden. Gøtzsche führt an, viele Ärzte würden solche Meldungen nicht machen: Das sei viel zu zeitaufwendig und bürokratisch, Pharmavertreter würden sie hinterher bedrängen und nicht immer würde eine Erkrankung mit dem Medikament in Verbindung gebracht. Unsere Erfahrung ist, dass die Dermatologen, die sich zum PsoNet zusammengeschlossen haben, in ihren Schulungen immer wieder auf die Register hingewiesen werden. Patienten sollten unbedingt mit dem Arzt darüber sprechen, wenn die Ursachen für einzelne Erkrankungen nicht zu klären sind. Was bleibt, sind 120.000 Todesfälle nach der Einnahme von Vioxx. Das Medikament wurde auch bei Psoriasis arthritis verschrieben. Der Firma Merck (MSD) wurde vor Gericht vorgeworfen, sie hätte sich eines „arglistigen, repressiven und frevlerischen“ Verhaltens schuldig gemacht. Natürlich hoffen wir alle, dass so etwas nie wieder passiert. Gøtzsche ist da extrem pessimistisch: „Wir trauen keinem Menschen, der uns wiederholt belogen hat, selbst wenn dieser Mensch manchmal die Wahrheit sagt“. Aber welche Alternative haben betroffene Patienten? Der Däne empfiehlt uns, möglichst sparsam Medikamente einzunehmen, bewusst die Vorteile gegen die Nachteile abzuwägen und sich politisch für industrie-ferne Experten und Gremien einzusetzen. Hinweise Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität – Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert Peter C. Gøtzsche, München 2015 Interview mit Peter C. Gøtzsche Süddeutsche Zeitung vom 05.02.2015 Themenverwandte Bücher Patient im Visier – Die neue Strategie der Pharmakonzerne Caroline Walter, Alexander Kobylinski, Hamburg 2010 Weiße Kittel – Dunkle Geschäfte – Im Kampf gegen die Gesundheitsmafia Dina Michels, Berlin, 2009 Korrupte Medizin – Ärzte als Komplizen der Konzerne Hans Weiss, Köln 2008 Der verkaufte Patient – Wie Ärzte und Patienten von der Gesundheitspolitik betrogen werden Renate Hartwig, München 2008 Kranke Geschäfte – Wie die Pharmaindustrie uns manipuliert Markus Grill, Hamburg 2007 Big Pharma –Das internationale Geschäft mit der Krankheit Jacky Law, Düsseldorf 2007
-

Lobbyismus im Gesundheitswesen - ein Kommentar aus Pharma-Sicht
Redaktion erstellte ein Artikel in Magazin
Eine Stellungnahme des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa) Das Thema Lobbyismus im Gesundheitswesen, das in schöner Regelmäßigkeit von den Medien aufgegriffen wird, wird in den allermeisten Fällen mit der Arbeit der Verbände und der Pharmazeutischen Unternehmen verknüpft. So auch bei der Tagung Ende September 2011 in Berlin, die von Transparency International und der Evangelischen Akademie veranstaltet wurde. In zahlreichen Vorträgen und Diskussionsbeiträgen wurde dabei der Pharmaindustrie sehr pauschal vorgeworfen, ihren Einfluss in allen Bereichen des Gesundheitswesens auf unlautere Weise geltend zu machen. Dabei wurde aber zum Teil mit veralteten Diagrammen und Zahlen (z.B. aus dem Jahr 2004) argumentiert und wurden längst bekannte, alte Vorwürfe unreflektiert wiederholt. Gerade in den letzten Jahren haben die Pharmaunternehmen und der vfa zahlreiche Anstrengungen in diesem Bereich unternommen. Dabei wurden in vielen Fällen die Forderungen von Transparency International erfüllt. Diese Entwicklungen blieben während der Veranstaltung aber leider völlig unerwähnt und wurden somit auch nicht gewürdigt. Für Deutschland gibt es zum Beispiel die „Verbändeliste“, in der viele – aber nicht alle Verbände aufgelistet sind, die bei Anhörungen des Bundestages zu Wort kommen können. In der aktuellen Liste erscheinen z.B. der vfa unter der Nummer 1910, Transparency international unter Nummer 1679 und Lobby Control unter Nummer 1531. Dies ist allerdings kein „Lobbyregister“, in dem sich alle eintragen müssen, die als Interessengruppe Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Seit mindestens 2008 fordert der vfa ein verpflichtendes Lobbyregister, in dem sich auch Kanzleien, Think-Tanks und Public Affairs-Agenturen eintragen. Auf EU-Ebene gibt es seit 2008 ein „Freiwilliges Lobbyregister“, in dem sich noch nicht sehr viele Verbände mit konkreten Angaben eingetragen haben. Der vfa war einer der ersten Verbände überhaupt, der aufgelistet hat, mit wie viel Personen und finanziellem Aufwand zu welchen Themen er im EU-Umfeld lobbyiert. Sogar noch früher, nämlich im Februar 2004, haben die Mitglieder des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller vfa die Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie (FSA) gegründet. Dieser Verein mit Sitz in Berlin überwacht die korrekte Zusammenarbeit von pharmazeutischen Unternehmen mit Ärzten, Apothekern und weiteren Angehörigen der medizinischen Fachkreise sowie den Organisationen der Patientenselbsthilfe. Der FSA sanktioniert gegebenenfalls Regelverstöße. Hierdurch wird den Verhaltenskodizes Nachdruck verliehen. Weitere Unternehmen und Verbände haben sich inzwischen dem FSA angeschlossen und sich seinen Verhaltenskodizes unterworfen. Anwendungsbeobachtungen (AWB) werden ebenfalls klar durch Kodizes geregelt. Die festgeschriebenen FSA-Leitlinien zu AWBs gehen deutlich über gesetzliche Vorgaben hinaus. Sie tragen dazu bei, die medizinisch-methodische Qualität der Studien zu sichern. Andere Aspekte sind ohnehin bereits eindeutig durch die "Empfehlungen zur Planung, Durchführung und Auswertung von Anwendungsbeobachtungen" des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bzw. des Bundesinstituts für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel "Paul-Ehrlich-Institut" (PEI) geregelt. So sehen die Leitlinien von BfArM / PEI wie auch die von der FSA vor, die Vergütung an der Gebührenordnung für Ärzte zu orientieren, um auszuschließen, dass von AWBs Verordnungsanreize für bestimmte Medikamente ausgehen. Alle Anwendungsbeobachtungen einschließlich der Liste der beteiligten Ärzte müssen zudem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) und dem BfArM oder alternativ dem PEI gemeldet werden. Der KBV und dem GKV Spitzenverband sind dabei auch die Art und die Höhe der geleisteten Vergütung anzugeben sowie die geschlossenen Verträge zu übermitteln. Besonders zu erwähnen ist hierbei, dass seit dem 01. Juli 2008 sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene Kodizes zur Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen gültig sind, die klare Regelungen für die partnerschaftliche Kooperation vorgeben und die notwendige Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit schaffen. Die Richtlinien des nationalen „FSA-Kodex Patientenorganisationen“ regeln die Kooperation zwischen Patientenorganisationen und Pharmaunternehmen. Ziel ist es vor allem, die Neutralität und Unabhängigkeit der Patientenorganisationen zu wahren und die lautere und sachliche Zusammenarbeit im Interesse der Patienten zu gewährleisten. Dieser „FSA-Kodex Patientenorganisationen“ greift bereits vorhandenen Verhaltensrichtlinien auf bzw. ergänzt sie, wie z.B. die Leitsätze der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe zur Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen. Der „FSA-Kodex Patientenorganisationen“ greift eine Vielzahl von ethischen Standards auf, denen sich die vfa-Mitgliedsunternehmen bereits in der Vergangenheit bei der Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen freiwillig unterworfen haben. Dazu gehört unter anderem, dass Unternehmen ihre finanzielle Unterstützung für Patientenverbände veröffentlichen müssen, dass sie keinen unlauteren Einfluss auf die Arbeit der Selbsthilfeorganisationen nehmen dürfen und dass sie keine Exklusivität in der Zusammenarbeit verlangen dürfen. Damit sind klare Maßstäbe gesetzt. Es ist sichergestellt, dass in der Zusammenarbeit von Patientenorganisationen und Industrie Verhaltensregeln eingehalten werden, die eine unlautere Beeinflussung ausschließen. Damit gehört der deutsche Patienten-Kodex europaweit zu den strengsten. Für die Pharma-Unternehmen, die für die Patientenarbeit die Summen ihrer Zuwendungen veröffentlichen, ist Transparenz keine Einbahnstraße. Auch von den anderen Playern im Gesundheitswesen wäre solch "gelebte Transparenz" wünschenswert. Selbst „die tageszeitung“ gibt in ihrem Artikel „Mehr Transparenz gefordert“ vom 01.09.2011 zu, dass ohne Großspenden der Pharmafirmen einige Selbsthilfevereine wohl dichtmachen müssten. Die Herkunft des Geldes aber würde von den Vereinen oft nicht kenntlich gemacht werden. Wörtlich fasst der Autor zusammen: "Dass sich in punkto Sponsoring-Transparenz zumindest bei den großen Pharmafirmen etwas bewegt hat, ist sicherlich zu begrüßen, und womöglich werden sich im Wettbewerb ums beste Image bald weitere Firmen an der relativen Offenheit von GlaxoSmithKline orientieren. [...| Der Kodex des Vereins 'Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie' (FSA) verlangt indes noch mehr: Die FSA-Mitgliedsfirmen müssen auch 'darauf hinwirken', dass Patientenorganisationen die finanzielle Unterstützung 'von Beginn an gegenüber der Öffentlichkeit kenntlich' machen. Angesichts dieser Vorgabe drängt sich die Frage auf: Wie mitteilsam sind eigentlich die Gesponserten selbst? Bisher gibt es weder eine einschlägige Datenbank in Eigenregie der Selbsthilfe noch eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung. Bei einer ersten Stichprobe auf den Websites diverser Patientenvereine sind jedenfalls kaum Angaben zu Sponsoren und Geldbeträgen zu finden. Klar ist allerdings auch: Die Offenlegung von Geldflüssen allein macht inhaltlich nur bedingt schlauer. Wie richtig gute Transparenz ausgestaltet sein könnte, hatte die Arzneimittelkommission der Bundesärztekammer bereits im Jahr 2008 skizziert: Notwendig sei ein öffentliches Register, in dem sämtliche Kooperationsverträge zwischen Pharmafirmen und Patientenorganisationen zentral dokumentiert sind. Am besten für jedermann und -frau anklickbar im Internet.“ Ob so ein "Kooperations-Register" tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, wird gegenwärtig heiß diskutiert. Der vfa hat das Ende solcher, erfahrungsgemäß langen Diskussionen nicht abwarten wollen, und mit seiner Selbstverpflichtung für Klarheit gesorgt. Würden sich jetzt alle Beteiligten, also Unternehmen wie Patientenorganisationen, daran halten, hätten wir ein hohes Niveau erreicht, ohne den Gesetzgeber bemühen zu müssen. Barbara Haake, Patientenzusammenarbeit vfa info@vfa.de-
- Bestechung
- Korruption
-
(und 2 mehr)
Markiert mit:
-
Auszüge einer politischen Diskussion Am 26. und 27. September 2011 fand eine Tagung in Berlin statt, in der es um Interessenpolitik, Einflussnahme und Korruption im Gesundheitswesen ging. Veranstalter waren Transparancy International Deutschland (TI) und die Evangelische Akademie zu Berlin. Im Mittelpunkt vieler Referate standen die Methoden der Pharmaindustrie. An Beispielen aus den unterschiedlichsten Bereichen wurde gezeigt, wie diese Branche systematisch, zielgerichtet und ausgestattet mit sehr viel Geld und bestens geschultem Personal ihre Interessen verfolgt. Aber auch andere Akteure im Gesundheitswesen betätigen sich als Lobbyisten und versuchen, Öffentlichkeit und Politiker in ihrem Sinne zu beeinflussen: Ärzte, Krankenkassen, Kliniken, Hilfsmittelhersteller und –vertreiber, Physiotherapie-Praxen und nicht zuletzt auch Selbsthilfevereinigungen. Immer wieder wurde kritisiert, dass viele Beteiligten es zugelassen haben, wie selbstverständlich Geld aus der Wirtschaft anzunehmen und deren Denkweise unkritisch zu übernehmen. Als roter Faden zog sich durch die Diskussion die Frage, was getan werden könnte, um die Interessen der Patienten gegen diese starke Lobby zu verteidigen. Transparenz bei Pharma-Aktivitäten Professsor Edda Müller von Transparency International (TI) fasste die wesentlichen Forderungen ihrer Organisation zusammen. Der Ruf der Pharmaindustrie sei vor allem dadurch beschädigt, dass sie die Preise von Arzneimitteln hochhalte und Schein-Innovationen auf den Markt bringe, die das Gesundheitswesen viel Geld kosten würden. Vertreter der Pharmaindustrie sollten nicht mehr an solchen Gesetzes-Entwürfen mitarbeiten dürfen, von denen sie selbst betroffen sind. Anwendungsbeobachtungen bei niedergelassenen Ärzten müssten verboten werden. Die würden nur dazu dienen, dem Arzt ein Gefälligkeitshonorar zu zahlen und sein Verschreibungs-Verhalten zu beeinflussen. Alle Forschungsvorhaben an Hochschulen, die von der Pharmaindustrie bezahlt werden, müssten in einem Register verzeichnet werden. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass Studien im Nachhinein nicht veröffentlicht werden, wenn der Pharmafirma die Ergebnisse nicht passten. Aus dem Publikum wurde vorgeschlagen, die Pharmaindustrie in einen gemeinsamen Topf einzahlen zu lassen. Daraus könnten dann die Forschungsgelder von einem unabhängigen Gremium verteilt werden. Anwesende Ärzte bestritten Professsor Müllers Aussage, dass die Pharmafirmen immer seltener Kongresse und andere ärztliche Fortbildung finanzieren würden. Unabhängige Kundenberatung Stefan Etgeton von der Bertelsmann-Stiftung ("Weiße Liste") stellte die Forderung auf, den Patienten im Gesundheitswesen als „Kunden“ zu akzeptieren. Das wurde im Publikum empört zurückgewiesen. Patienten seien keine „Kunden“, die freiwillig ein Geschäft abschließen. Sie seien kranke Menschen, die notgedrungen medizinischer Hilfe bedürften. Etgeton gelang es nicht aufzuzeigen, dass in vielen Situationen der Patient schon längst „Kunde“ ist und entsprechend beeinflusst wird. Der Patient muss Gesundheitsangebote einschätzen, z.B. wenn er „IgEL“- oder andere Selbstzahler-Leistungen angeboten bekommt. Es fällt den meisten schwer zu entscheiden, in welcher Klinik oder Facharztpraxis man sich behandeln soll. Dafür braucht man einen möglichst unabhängigen Lotsen – ob nun Krankenkasse, Unabhängige Patientenberatung, Verbraucherzentrale, „Weiße Liste“, Selbsthilfe-Angebote oder ähnliches. Persönliche Interessen beeinflussen Urteilsvermögen Professsor Bruno Müller-Oerlinghausen (früher: Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft) verwies darauf, dass ein Teil der Ärzteschaft durch zu enge Verbindungen zur Gesundheitswirtschaft seine innere und äußere Unabhängigkeit verloren habe. Ärzte riskierten, dass ihr rein professionelles Urteilsvermögen beeinflusst werde durch „sekundäre Interessen“ (Geld, Karriere, Status, Vorteile). Darauf angesprochen würden die meisten das zwar bei Kollegen vermuten, fast nie aber bei sich selbst. Er wies auf die Ärztegruppe MEZIS hin, die generell keinerlei Vorteile von Pharmafirmen in Anspruch nimmt. Professsor Müller-Oerlinghausen beschrieb Desinformations-Kampagnen, mit denen die Pharmafirmen erfolgreich ihre Denkweise durchsetzen und Marktanteile für die eigenen Produkte erweitern konnten: Übertreiben von Infektionsgefahren, behaupteter Zusatznutzen neuer Medikamente, Erfinden von Krankheiten, Beeinflussen von Behandlungsleitlinien, Verändern von Grenzwerten, ab wann jemand als behandlungsbedürftig gilt. Ähnlich argumentierte Professor David Klemperer vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Es dürfe nicht erlaubt sein, dass Ärzte mit Interessenkonflikten die „Leitlinien“ (Behandlungsempfehlungen) für einzelne Krankheiten mitentscheiden. So seien z.B. die Cholesterin-Grenzwerte in US-Leitlinien so verändert worden, dass von vorher 13 Mio. Betroffenen, danach 36 Mio. Menschen hätten medikamentös behandelt werden müssen. Es sei erwiesen, dass gerade diejenigen Ärzte, die sich selbst für nicht beeinflussbar halten, besonders anfällig dafür seien („verzerrte Eigenwahrnehmung“). Das Argument, wer von allen Geld nähme, sei nicht beeinflussbar, sei eine nicht bewiesene Behauptung, so Professor Klemperer. Patientenvereinigungen In den vergangenen Jahren wurde heftig darüber diskutiert, inwieweit Selbsthilfeorganisationen durch Gelder aus der Gesundheitswirtschaft beeinflusst werden. Dr. Martin Danner (BAG Selbsthilfe) verwies darauf, dass es inzwischen Regeln über die Zusammenarbeit mit solchen Firmen gäbe, um die Unabhängigkeit des jeweiligen Mitgliedsverbandes zu gewährleisten. Alle Zahlungen seien zu veröffentlichen. Verstöße würden in einem „Monitoring-Verfahren“, d.h. einer internen Selbstkontrolle, besprochen. Darüber hinaus aber nannte er keine Probleme oder Beeinflussungs-Mechanismen, die durch die Zusammenarbeit der Patienten-Selbsthilfe mit zum Teil global agierenden Pharmakonzernen entstehen könnten. Lobbyismus als latente Gefahr für den Rechtsstaat Der schärfste Kritiker eines unregulierten Lobbyismus auf dieser Tagung war Professsor Thomas Leif (netzwerk recherche). Anhand drastischer Beispiele machte er deutlich, dass Politiker, Journalisten, Medien und sogar Internet-Communities von Lobbyisten beherrscht werden. Sie würden selbst vor „Under-Cover“-Methoden nicht zurückschrecken, um die Schwächen ihres Gegenübers auszunutzen. „Gegen die Pharmaindustrie kann in Deutschland niemand regieren“, zitierte er einen SPD-Minister. In nahezu allen Gremien habe man „seine“ Leute platziert – von ärztlichen Fachgesellschaften und wissenschaftlichen Beiräten der Patientenorganisationen, über den Bundestag, Ministerien und Bundesinstitute bis hin zur Weltgesundheits-Organisation WHO. „Leihbeamte“, bezahlt von der Pharmaindustrie, formulieren in Behörden Gesetzes- und Verordnungsvorschläge – vorgeblich als „fachkundige Helfer“ der Politik. Die Schwächen der Politiker und ihr fehlendes Expertenwissen, seien das „Scheunentor“ der Lobbyisten. Dr. Leif bezeichnete den heutigen Zustand als eine „symbiotische Komplizenschaft“. Jeder, der mit Lobbyisten zusammen arbeite, begebe sich in eine „freiwillige Interessenabhängigkeit“. Das sei aber keine Kooperation unter Gleichen: Der Lobbyismus im Gesundheitswesen sei perfektioniert. Pharmafirmen arbeiten mit gewaltigen Finanzmitteln und absolutem „Top-Personal“. Den vermeintlichen Interessenkonflikt zwischen Pharmaindustrie, Ärzten und Kassen gäbe es nicht, so Professsor Leif. Ganz im Gegenteil seien da vielfältige Kooperationsformen und gemeinsame, aggressive Forderungen nach Sonderrechten und immer mehr Geld. Der eigentliche Skandal sei, dass das alles so durchgehe. Er halte diese „Überlobbyisierung“ der Politik für eine zunehmende Gefahr für den Rechtsstaat und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Demokratie. Kein Interesse an Strafverfolgung Mit Vergehen gegen das Strafrecht beschäftigt sich Dina Michels (KKH-Allianz) seit langer Zeit. Sie hätte viele Fälle aufgedeckt, in den Ärzte finanziell von Sanitätshäusern, Physiotherapie-Praxen oder Kliniken Vermittlungsprovisionen bezogen. Es seien unzulässige Beraterverträge oder vorgetäuschte Anwendungsbeobachtungen entdeckt worden. Aber nur in den ganz offensichtlichen Fällen wären Mediziner dann auch verurteilt worden. Ihr sei es immer wieder passiert, dass Staatsanwälte vom Justizministerium „zurückgepfiffen“ worden seien. Andere Ankläger, die sich ausschließlich mit Arztverfahren beschäftigen würden, hätten „nicht Bescheid gewusst“, angeordnete Hausdurchsuchungen abgeblasen und letztendlich das Verfahren eingestellt. Trotzdem ermuntere sie weiterhin jeden, Anzeige zu erstatten, der von Abrechnungsbetrug erfahre. Schließlich gehe es um das Geld der Versicherten. Das könne man auch anonym machen, z.B. auf der Seite der KKH-Allianz oder beim Landeskriminalamt des jeweiligen Bundeslandes. Lobbyismus ist für Politiker unerlässlich Dr. Eva Högl (MdB, SPD) vertrat die Position der „aufgeklärten“ Bundestagsabgeordneten: Natürlich lasse sie sich nicht durch luxuriöse Einladungen beeinflussen. Politiker würden aber Experten benötigen, um sich fachlich beraten zu lassen. Selbstverständlich dürfe man sich nicht zum Sprachrohr von Einzelinteressen machen lassen. Sondern man müsse sich alle Seiten anhören, um dann souverän selbst zu entscheiden. Dr. Högl sprach sich dafür aus, dass sich der Bundestag selbst Regeln geben sollten: Wie sollte mit Bestechung von Abgeordneten umgegangen werden? Nach welcher Karenzzeit dürften Politiker in die Privatwirtschaft wechseln? Aus dem Publikum wurde sie gefragt, weshalb sie nicht mit unabhängigen Experten zusammenarbeiten würde. Darauf erwiderte sie, dass es keine wirklich unabhängigen Experten gäbe. Das Publikum dagegen protestierte und war anderer Meinung. Mobilisierung über das Internet Dr. Günter Metzges (Campact) stellte einige Kampagnen vor, die zeigen sollen, wie einfach es mit heutigen Kommunikationsmitteln ist, seine Interessen zu vertreten. Über das Internet kann man ohne großen Aufwand Menschen mobilisieren: So hätte Campact Aktionen gegen Gen-Food auf Wahlveranstaltungen von nur zehn Bundestagsabgeordneten durchgeführt, die sie als einflussreich ausgesucht hatten. Die mussten sich dann bei jedem ihrer Auftritte dazu äußern. Ohne diese Aktionen hätten sich die Abgeordneten nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt und unreflektiert abgestimmt. Patienten sollen über Therapie mitentscheiden ("shared decision making") Professsor Ingrid Mühlhauser (Uni Hamburg, MIN Fakultät, Gesundheitswissenschaft) hat sich zum Ziel gesetzt, dass Patienten wissenschaftliche Aussagen zu Therapien verstehen können. Nur so können sie unabhängig darüber mitentscheiden, ob sie sich mit einem Medikament behandeln lassen oder aber ob es ihnen zu riskant ist. Patienten müssen glauben, was ihnen der Arzt, eine Pharmabroschüre oder ein Medienbericht über Nutzen und Risiko eines Medikaments sagen. Aber die genannten Zahlen sind meist untauglich, wenn ein Patient sein persönliches Risiko abschätzen will: Sie verschweigen starke Nebenwirkungen oder altersmäßige Unterschiede, sie machen Panik und unterschlagen weit aus gefährlichere Lebensrisiken. Professsor Mühlhauser hat deshalb Kurse für Krebs-Patienten entwickelt, in denen diese lernen, die Aussagen von Medikamenten-Studien einschätzen zu können. Eine Petition an den Bundestag, Behandlungsleitlinien und wissenschaftliche Studien allen Bürgern in verständlicher Sprache zugänglich zu machen, wurde abgelehnt. Dafür gäbe es die Unabhängige Patientenberatung, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und das Qualitätssiegel Afgis. Professsor Mühlhauser hielt unter den vielen Patientenportalen eigentlich nur den Gesundheitsfuchs des IQWiG für unabhängig. Das Patienten-Informationsportal der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hielt sie für "problematisch", weil es stark leitlinienorientiert sei und nicht die notwendigen Informationen für persönliche Entscheidungen biete. Die Patientenportale der Krankenkassen seien nicht wissenschaftlich und nicht frei von Marketing-Interessen. Auch die Sieger der Stiftung Warentest müsse man kritisieren: Die Apotheken-Umschau sei eine reine Ratgeberseite, Netdoktor und Vitanet seien wissenschaftlich veraltet. Hinter Vitanet stehe die Felix-Burda-Stiftung. Fazit Auch nach zwei Tagen gab es nicht „den“ Vorschlag, wie Patienten sich in diesem Interessen-Geflecht behaupten können. Der Einfluss der Pharmaindustrie wurde in allen Berichten als mächtig und übermächtig dargestellt – oft genug von den Beteiligten schon als selbstverständlich verinnerlicht. In den vergangenen Jahren sind Stück für Stück immer mehr Institutionen entstanden, die Patienten unabhängig informieren und sich für deren Rechte einsetzen. Die gilt es zu stärken und zu einzelnen Kampagnen zusammen zu bringen. Ein erster Fortschritt ist, dass nicht mehr alles im Geheimen stattfindet. Politisch muss noch mehr Transparenz gefordert werden, um zu erkennen wo und wie genau die Gesundheitswirtschaft Einfluss ausübt. Bei Entscheidungen muss darauf bestanden werden, dass interessengeleitete Experten durch unabhängige ersetzt werden. Offiziell wurde bedauert, dass der Patientenbeauftragte der Bundesregierung auf dieser Tagung nicht vertreten war. Im Publikum wies man darauf hin, dass Herr Zöller sich zu diesem Problembereich bisher auch noch nicht politisch verhalten habe. Einzelne Beiträge der Tagung finden sich auf der Seite der Evangelischen Akademie zu Berlin. Bücher zum Weiterlesen: Interessenkonflikte in der Medizin, Klaus Lieb, David Klemperer, Wolf-Dieter Ludwig Der Pharma Bluff, Marcia Angell Patient im Visier, Caroline Walter, Alexander Kobylinski Weiße Kittel, dunkle Geschäfte, Dina Michels Kostenlose Veröffentlichungen zum Weiterlesen: Bestellte Wahrheiten, Thomas Leif Die Politikflüsterer, Thomas Leif In der Lobby brennt noch Licht, nr-Werkstatt Nr. 12
-
- Bestechung
- Korruption
-
(und 3 mehr)
Markiert mit:
-
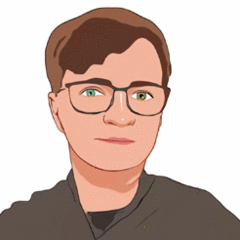
Studien - weniger direkt, aber mehr Pharma-Einfluss
Claudia Liebram erstellte ein Artikel in Forschung
Alle paar Jahre setzen sich Forscher hin und ziehen Bilanz: Was für Studien sind in den letzten Jahren gelaufen? Wie liefen sie ab, wie lange dauerten sie, welche Folgen hatten sie - und: wer hat sie bezahlt? Europäische Forscher haben dazu zum wiederholten Male randomisiert kontrollierte Studien verglichen – also jene, in denen die Patienten nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe zugeordnet und die Ergebnisse mehrerer (meist zweier) Gruppen verglichen werden. Diesmal ging es um Studien aus den Jahren 2001 bis 2006. Die Vorgänger-Version hatte sich mit Studien aus den Jahren 1997 bis 2000 befasst. Das Ergebnis Im jüngeren Zeitraum gab es 140 solcher randomisiert kontrollierten Studien - deutlich weniger als zuvor, wo es 249 waren, obwohl "damals" zwei Jahre weniger einbezogen waren.Der Anteil plazebokontrollierter Studien hat sich erhöht - von 44,6 auf fast 70 Prozent.Eine Studie dauert im Durchschnitt 12 Wochen - vorher waren es 7 Wochen.Der PASI wurde als Kriterium jetzt deutlich öfter verwendet - nämlich in 57,7 Prozent der Studien. Vorher waren es 30,6 Prozent.Die Lebensqualität zählte als Krterium nun auch deutlich öfter - 7,7 Prozent der Studien gingen darauf ein. Von den früheren Studien taten das nur 0,4 Prozent.Der Anteil der von Pharmafirmen unterstützten Studien ist dann auch deutlich gestiegen - von 61 auf 73,7 Prozent der Studien. Die Forscher ziehen ein Fazit: "Obwohl es neue Behandlungsoptionen gibt, ist die Zahl der direkten Vergleichsstudien zurückgegangen", schreiben sie. "Die meisten Versuche zielen auf einen kurzfristigen Effekt ab - was vielleicht den verstärkten Einfluss des Sponsorings aus der Industrie auf die Forschungsthemen widerspiegelt." Quelle: Comparators, study duration, outcome measures and sponsorship in therapeutic trials of psoriasis: update of the Eden Psoriasis Survey 2001-2006", in: British journal of dermatology, Februar 2010 -

Die Pharmaindustrie und deren Einflussnahme auf Selbsthilfe
Gast erstellte einem Thema in Am Rande bemerkt
Wer gut schmiert, der gut fährt. So heisst ein altbekannter Spruch. Mal wieder fällt es mir ein. Ein Thema was mir immer wieder mal sporadisch in den Kopf kommt und was ich schon lange mal euren Meinungen aussetzen wollte. Auf geht's: Dass verschiedene Selbsthilfegruppen und Dachorganisationen sich von Mittelannahme durch Hersteller distanzieren und diese kategorisch ablehnen, ist ja bekannt. Als Beispiel erwähne ich mal die Psoriasis Selbsthilfe Arbeitsgemeinschaft, die ja einen der Dachverbände um unsere Erkrankung darstellt. Mal wieder ausgelöst durch diesen Thread und jenen Artikel aus 2006 nehme ich es zum Anlass die, aus meiner Sicht, längst fällige Diskussion zu starten. Besonders stößt mir persönlich der Deutsche Psoriasis Bund e.V. auf. Das hat 2 Gründe. Zum einen habe ich persönlich relativ ablehnende Erfahrungen mit dieser Vereinigung gemacht und ich stoße mich daran dass dieser DPB als Einziger von den Mitgliedern Jahresbeiträge verlangt. Sicher ist beides subjektiv, doch lasst mich bitte dieses Beispiel weiterführen. Recherchiere ich im Web, so komme ich sehr flüchtig nachgelesen auf ganz viele Sponsoringgeständnisse diverser Pharmaunternehmen. Hier mal die Suchergebnisseiten dazu bezügl. Gabe in 2008 an den DPB: http://www.bayerscheringpharma.de/scripts/pages/de/gesellschaftliches_engagement/verantwortlich_handeln_/patientenorganisationen/index.php 6005 Euro http://www.abbott.de/content/e36/e13005/e13850/ZuwendungenanPatientenorganisationen_final_31Mar09_de.pdf 5000 Euro http://www.wyeth.de/pdf/Patientenarbeit_2008_finalV16092009.pdf 20455,76 Euro http://www.essex.de/essex/cms/content/unternehmen/patientenorganisationen/docs/Deutscher_Psoriasis_Bund.pdf 12209,25 Euro http://www.biogenidec.de/biogenidec/patientenorganisationen/transparenzinitiative/content-161958.html 9818 Euro Das sind nur die ganz schnell gefundenen Ergebnisse. Würde ich mir Zeit zum suchen nehmen, so könnte ich die Liste sicher noch lange fortsetzen. Irgendwo widerspricht in mir drin diese Sache den Leitsätzen des DPB. Sie nehmen sehr viel an und tun, aus meiner subjektiven Sicht gesehen, so uneigennützig. In mir drin kann ich das nicht so recht realisieren, zumal auch noch Kassenzuschüsse laufen. Sorry dass ich den Link dazu weg habe. Zur Not müsste ich ihn noch mal suchen. Und was will ich jetzt? Ich will nur wissen ob ihr dieses Techtelmechtel der Pharmaindustrie mit einem der großen Selbsthilfeverbände auch so merkwürdig anseht. Und ich möchte dass ihr unvoreingenommen durch meinen Text eure persönliche Meinung und Ansicht dazu tippt. Danke für Lesezeit und Gruß Wolfgang -
Das habe ich gesehen und mich tierisch aufgeregt, was haltet ihr davon? Vor allem der Film ist interressant, da wird wenigstens mal erwähnt das wir nur noch 2 Forschungslabors in Deutschland haben, der rest ist Global. Aber schaut mal selbst. http://www.daserste.de/plusminus/beitrag_dyn~uid,aiv6vrblk7rzfufj~cm.asp
-
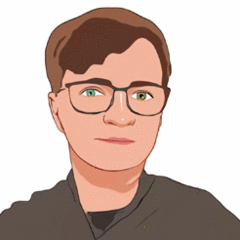
Studien – was sie bringen, was du wissen solltest
Claudia Liebram erstellte ein Artikel in Forschung
Vor- und Nachteile Firmen und Umfrage-Institute haben den Schuppenflechte-Patienten zunehmend für ihre Forschungen und Erhebungen entdeckt. Diese Studien sind für die, die an Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis leiden, die beste Möglichkeit, an die teuren und auch noch länger ausstehenden Medikamente zu kommen. Natürlich läuft jeder Teilnehmer "Gefahr", dass ausgerechnet er ein Placebo zugeteilt bekommt – ein wirkungsloses Schein-Medikament. Das ist allerdings für eine seriöse Studie unverzichtbar. Manches mal ist allerdings ein Handel möglich: Der Patient nimmt zunächst, was kommt. Im Gegenzug lässt er sich versprechen, dass er danach auf jeden Fall von dem Medikament etwas abbekommt. Die Haut- oder Rheuma-Kliniken der Universitätskliniken sind die erste und beste Adresse für den potentiellen Studien-Teilnehmer. Hier lohnt der Anruf in der nächstgelegenen Universität. Viele Kliniken verzeichnen auch auf eigenen Internetseiten, welche Studien gerade laufen. Zwei Ratgeber informieren aus unserer Sicht gut über Studien, ihre Vor- und Nachteile und das Vorgehen: "Klinische Studien - Ein Ratgeber für Studienteilnehmer, Angehörige und Interessierte" von der Berliner Charité "Klinische Studien - Antworten. Hilfen. Perspektiven" von der Deutschen Krebshilfe Außerdem sei dieser Film empfohlen: Studien finden Wer an einer Studie teilnehmen will, sollte bei der Suchmaschine seiner Wahl nach "Studie Psoriasis" suchen, gefolgt vom Namen der nächsten (oder der eigenen) großen Stadt. (Beispiel: Studie Psoriasis Berlin). Oft schreiben die Hautkliniken der Universitäts-Kliniken auch, für welche Studien sie gerade Teilnehmer suchen. In unserem Klinikverzeichnis finden Sie bestimmt auch eine Einrichtung in Ihrer Nähe und einen Hinweis auf deren Internetseite. In unserem Adressverzeichnis finden Sie Studienzentren in Ihrem Postleitzahlbereich oder einige bundesländerübergreifende oder bundesweite Einrichtungen. Informationen über den Inhalt einer Studie Eine Anlaufstelle für die Suche nach Informationen über eine Studie ist das EU Clinical Trials Register. Eine einfache Eingabe eines Wortes in die Suchfunktion ergibt zu viele Ergebnisse. Sinnvoller ist die "Erweiterte Suche" ("Advanced Search"), bei der man das Datum eingrenzen kann (nur Studien der letzten 2 Jahre, nur in Deutschland z.B.) oder den Wirkstoffnamen hinzufügen kann, wenn man ihn schon weiß. Beim Suchergebnis kann man nach der jüngsten Studie suchen und sieht in der untersten Zeile jedes Ergebnisses, in welchem Land die Studien dazu laufen. Ein Klick auf "DE" hilft dann weiter. Anwendungsbeobachtungen Diese Art Studien ist umstritten, weil damit auch bemäntelt wird, dass eine Firma einem Arzt auf irgendeine Art Vorteile gewährt, wenn er nur genügend Patienten für diese Studien gewinnt. Dann geht es mehr um Marketing als um echten Erkenntnisgewinn. Auf der anderen Seite können diese Anwendungsbeobachtungen aber auch zeigen, welche Probleme mit einem Medikament im Alltag auftauchen: Erst dann bekommen zum einen viel mehr und zum anderen völlig "normale" Patienten das Medikament - also Menschen jeden Alters, mehr Frauen, mehr Ältere, Patienten mit zusätzlichen Krankheiten. Das ist in den Studien in Kliniken etc. nicht so der Fall. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) führt auf seiner Internetseite eine Datenbank mit Anwendungsbeobachtungen - das Register nicht-interventioneller Studien. Erfahrungen von Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis: Schau Dich in unserem Forum um. Interessante Artikel zum Thema Wie jeder Experten und Studien selbst checken kann (Quarks, 29.10.2022) Da wird ein YouTube-Video als Beweis genannt, dass ein Mittel oder eine Methode total toll hilft. In einer WhatsApp- oder Facebook-Gruppe wird im Brustton der Überzeugung dargelegt, warum etwas so und nicht anders ist. Ihr sitzt dann aber doch da und denkt: "Hmmh, kann das stimmen? 🤔 Sollte es wirklich so einfach sein?" Manche Antworten geben die Science Cops von der Sendung "Quarks". Gern könnt Ihr auch uns fragen. Aber eigentlich kann jeder selbst solche Ausagen überprüfen. Wie, wird in dieser Folge der Science Cops erklärt. Warum Erfolge in Versuchen an Mäusen eben nicht immer beim Menschen funktionieren (Gehirn & Geist, 02/2015) Nur ein Drittel der Erfolge, die aus Mausversuchen gemeldet werden, lassen sich später am Menschen wiederholen. Sind von der Industrie gesponserte Studien automatisch wertlos? (Süddeutsche Zeitung, 29.11.2014) Eine Studie ist von Firma XY in Auftrag gegeben? Ist doch klar, dass deren Medikament am Ende super dasteht. Oder? Hanno Charisius argumentiert tapfer, warum das nicht so einfach ist: Studien zeigen oft nicht, wie es dem Menschen wirklich geht (Süddeutsche Zeitung, 17.10.2014) In der Süddeutschen Zeitung schreibt Werner Bartens, dass Studien oft ein wichtiges Detail vergessen: wie sich der Patient fühlt, wie er die Therapie empfunden hat. Und manches mal sind die Studien schlicht zu kurz. Ergebnisse von Studien nicht länger geheim (Die Zeit, 03.04.2014) Klinische Studien zum Beispiel für neue Medikamente müssen künftig öffentlich angemeldet werden. Wer die Tests durchführt, muss die Ergebnisse veröffentlichen. Was selbstverständlich klingt, ist jetzt (erst) vom Europäischen Parlament beschlossen worden. Ein Grund für die Regelung: Bislang verschwanden Studien schon mal in Schubladen, wenn sie nicht so günstig ausfielen. Soll ich an einer klinischen Studie teilnehmen? (journalMED, 14.02.2014) Ein Informationsblatt für Patienten steht kostenlos zum Ausdrucken bereit. Auf zwei Seiten erfahren Interessierte, warum klinische Studien wichtig sind und worauf sie bei einer Teilnahme achten sollten. Ergebnisse von Studien müssen nun veröffentlicht werden (Die Zeit, 21.12.2013) Monatelang wurde gerungen - nun steht die EU-Verordnung für klinische Medikamententests am Menschen. Die Tests sollen in der Europäischen Union künftig einheitlich ablaufen. Die wichtigsten Änderungen: Die Neuregelung sieht vor, dass alle Studien unabhängig davon, ob sie in oder außerhalb Europas durchgeführt werden, in einem zentralen und öffentlichen Register gelistet werden. Dass eine Zusammenfassung ihrer Ergebnisse spätestens ein Jahr nach Ende Studie veröffentlicht wird. Und dass dies geschieht, ganz gleich, ob das Medikament zugelassen wurde oder nicht. Es gibt aber Ausnahmen: Geschäftsgeheimnisse und Patientendaten. Sollen Studien komplett veröffentlicht werden – mit allen Nebenwirkungen? (taz, 18.10.2013) Wissenschaftliche Studien sind ohne Frage aufwändige Proceduren, doch ihr Ergebnis beschert mancher Pharmafirma am Ende immense Einnahmen. Und so tobt ein Streit: Sollen alle Ergebnisse von Studien und andere Informationen wie sämtliche Nebenwirkungen veröffentlicht werden - oder können Pharmafirmen sie zu Geschäftsgeheimnissen erklären und damit der Öffentlichkeit vorenthalten? Die taz hat den Hintergrund zu dieser Debatte aufgeschrieben. Unabhängige Studien scheitern an der EU-Bürokratie (Die Zeit, 21.02.2013) Gebärden sich EU-Kommissare als Schergen der Pharmalobby? Die derzeitige Debatte um eine geplante EU-Richtlinie legt das nahe. ... Das eigentliche Ziel des Gesetzesentwurfs gerät in der erbitterten Debatte aus dem Blickfeld: Ursprünglich ging es um einheitliche Standards. Die Vorgaben sollten endlich entbürokratisiert werden. "Es kommt offenbar vor, dass Studien nicht publiziert werden" (Deutschlandradio Kultur, 13.07.2011) Ein forschender Arzt antwortet auf massive Kritik an medizinischer Forschung, die nach seiner Meinung zu sehr von der Pharmaindustrie abhängt. Das Problem liegt aber nicht nur bei besagter Pharmaindustrie. Die Frage ist auch: Wie kann Forschung wirklich unabhängig sein und wie kann mehr öffentliches Geld dafür aufgewendet werden? Was ein Proband mit Psoriasis erlebt (taz, 18.3.2000) "Also, ich seh nichts", "Da. Vielleicht" und "Ich geb dem mal 'ne Null" – das bekommt ein Studienteilnehmer schon mal zu hören, wenn über den Erfolg oder Nicht-Erfolg eines Medikaments geurteilt werden soll. Hier hat ein taz-Autor aufgeschrieben, wie es ihm in einer Studie in Hamburg erging. Weitere Links Zentrum für Klinische Studien Leipzig Das Zentrum beantwortet Fragen, die wohl jedem durch den Kopf gehen, wenn er über Studien nachdenkt. Soll ich an einer klinischen Studie teilnehmen? Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin bietet ein zweiseitiges Blatt mit Informationen über Studien und die Teilnahme an. Versuchskaninchen? Nein danke! Dr. Sylvia Sänger hat in einem Podcast-Beitrag erzählt, warum klinische Studien wichtig sind. Broschüren zum Thema Studien Patienten in klinischen Studien Sehr sachlich wird über die wesentlichen Aspekte der Teilnahme an einer klinische Studie bzw. klinischen Prüfung (beim Arzt) aufgeklärt. Offen bleibt, ob alle Aussagen auch dann zutreffen, wenn ein kommerzielles Studienzenter, dass für die Teilnahme Geld bezahlt, eine Medikamenten-Prüfung durchführt. Vielleicht hätte für manche Patienten deutlich hervorgehoben werden soll, dass die Teilnahme an einer Studie keine akute Behandlung ist. Der Patient muss damit rechnen, dass das Medikament eventuell bei ihm nicht so gut wirkt oder er in der Placebo-Gruppe ist. Die Broschüre wurde vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller herausgegeben. Man kann nicht erwarten, dass in einer Broschüre der Pharma-Lobby selbstkritisch darüber nachgedacht wird, in welchem Fall eine Studie abgebrochen wird (Patient ist auf jeden Fall versichert!). Wer sich darüber informieren will, wie viele viele Studien nicht veröffentlicht werden bzw. welche Ergebnisse davon abhängen, wer die Studie bezahlt, muss sich woanders informieren. Herunterladen | Bestellen Kinder und Jugendliche in klinischen Studien Sachliche Erläuterung der wesentlichen Punkte, die Eltern wissen wollen, wenn ihr Kind für eine medizinische Studie vorgeschlagen wird. Immer mehr Psoriasis-Medikamente werden für Kinder zugelassen. Ein Argument, das eigene Kind an einer Studie teilnehmen zu lassen ist, dass die Kinder intensiver untersucht und betreut werden, als es im Alltag der Dermatologen möglich wäre. Eltern sollten auf jeden Fall das Pro und das Contra erwägen und ruhig auch einen zweiten Arzt fragen, bevor sie ihr Kind für eine Studie anmelden. Der Herausgeber, der vfa, ist einer der großen Lobby-Verbände der Pharma-Industrie. Herunterladen | Bestellen Mehr zum Thema im Psoriasis-Netz ➔ Übersicht: Hier werden aktuell Studienteilnehmer gesucht ➔ Tipps: Studien – was sie bringen, was du wissen solltest ➔ Lexikon: Fachbegriffe von A bis Z- 1 Kommentar
-
- Pharmaindustrie
- Psoriasis Forschung
-
(und 1 mehr)
Markiert mit:
-

Sind Psoriasis-Begleiterkrankungen eine "Erfindung" der Pharmaindustrie?
Rolf erstellte einem Thema in Expertenforum Begleiterkrankungen
Immer wieder wird von Psoriasis-Betroffenen der Verdacht geäußert, die Warnungen vor (lebensgefährlichen) Begleiterkrankungen könnten völlig übertrieben sein. Es seien vor allem Pharmafirmen, die seit einigen Jahren Studien und Projekte zu „Komorbiditäten“ finanzieren und sie entsprechend auslegen. Damit würden sie sich die wissenschaftliche Begründung „erkaufen“, weshalb (ihre) Psoriasis-Medikamente dauerhaft und lebenslang genommen werden müssten. Wenn man bei anderen Krankheiten genauso intensiv forschen würde, erhielte man vermutlich ähnliche Ergebnisse. Fast jede Krankheit kann auch weitere Krankheiten provozieren. Was würden Sie solchen kritischen Patienten antworten? -
Hallo Ihr, wir waren kürzlich in München auf der Hautärzte-Tagung. Mir war gleich am Flughafen aufgefallen, dass da auf der Abflug-Tafel riesige Werbung für die Psoriasis-Info-Seite einer Pharma-Firma lief. Auch auf Bahnhöfen und im Stadtbild war die Werbung immer wieder zu finden. Nun hat eine Twitter-Nutzerin das Motiv kritisiert – wegen der Rolle der Frau. Dieser Aspekt war uns gar nicht in den Sinn gekommen. Darauf antwortete die Organisation Pinkstinks: Was meint Ihr denn zu dieser Werbung?
-
Ich habe vor kurzem bei meiner Krankenkasse angerufen und angefragt, wie es mit einer Kur am Toten Meer steht. Zumal das die einzige Maßnahme war, die mir bisher geholfen hat. Ich war dreimal, zuletzt 2003 am Toten Meer und bin immer erscheinungsfrei gewesen. Das hielt mindestens sechs Monate an und danach kam die Psoriasis auch erst in Schüben und langsam wieder. Das sei sehr schwierig, wenn nicht aussichtlos. Dabei habe ih darauf verwiesen, dass mein Zustand immer akuter geworden ist, ich seit dem vergangenen Jahr, Fumaderm, zwei Wochen Hautklinik, MTX, zwei Studien hatte und jetzt letztlich Humira kriegen soll. Da müsste zumindest der Kostenfaktor eine Rolle spielen, dachte ich mir. Humira kostet im Jahr etwa 21000 EUR. Die Kur etwa 3200 EUR. Ich würde eine Behandlung kriegen, von deren Wirkung ich überzeugt bin und die Krankenkasse würde sich eine Menge Geld sparen. Naja, die wollen einem bei so etwas aber nicht helfen... Also habe ich seit gestern Humira im Wert von 5320,87 EUR im Kühlschrank. So kann man die solidarischen Systeme dieses Landes auch einfach mal für die Pharmaindustrie arbeiten lassen. Bin in Fürth, Mittelfranken. Ist jemand von euch in einer wirtschaftlich und logisch denkenden Krankenkasse? Viele Grüße
- 5 Antworten
-
- Humira Erfahrungen
- Krankenkasse
-
(und 2 mehr)
Markiert mit:
-
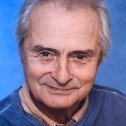
Informationskampagne "Forschung ist die beste Medizin" suchte Psoriatiker
Rolf Blaga erstellte ein Artikel in Forschung
Der „Verband Forschender Arzneimittelhersteller“ (VfA) plante, ab Mitte April 2007 die Krankheit Psoriasis ins Rampenlicht zu stellen. In bundesweit gesendeten Fernsehspots sollten Menschen mit Schuppenflechte erklären, dass sie dank eines „bewährten oder innovativen Medikaments“ erfolgreich behandelt wurden. Dabei sollten sie ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Forschung ist die beste Medizin“ tragen. Gesucht wurden Psoriatiker, deren Gesundheitszustand sich durch ein Medikament deutlich verbessert hat und die sich trauen, vor einer Kamera über ihre Krankheit zu sprechen. Anfang März 2007 fanden Dreh- und Fototermine in Berlin statt. Die Reise- und Hotelkosten wurden übernommen. Im Internet sollte eine Dokumentation über jeden Fall veröffentlicht werden. Die Bewerber sollten genug Zeit haben, um danach für weitere Pressegespräche oder Interviews zur Verfügung zu stehen. Die PR-Agentur versprach, jeden entsprechend zu betreuen. Wir wissen, dass Foto- und Filmshootings zustanden kamen. Auf dem Flughafen Berlin-Tegel war auch einmal kurz ein Ergebnis davon mit einem Psoriasis-Patienten zu sehen. Die Psoriasis-Spots wurden jedoch nie groß verbreitet, die gesamte Kampagne später eingestellt. Unser Kommentar Die Kampagne des VfA gab es seit 2005. Patienten, die an Rheuma, Multipler Sklerose, Brustkrebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall erkrankt waren, zeigten sich öffentlich unter dem Motto „Forschung ist die beste Medizin“. Was ist der Sinn einer derartigen PR-Kampagne? Wer soll davon überzeugt werden, dass Forschung sehr wichtig und das Geld dafür gut angelegt ist? Der „Verband Forschender Arzneimittelhersteller“ ist eine Vereinsgründung der Pharmaindustrie. Es kann also bei der Kampagne nicht darum gehen, die Politiker aufzufordern, mehr Steuermittel für die Forschung auszugeben. Vielmehr sollen doch wohl zufriedene Patienten als Kronzeugen dafür auftreten, dass es neu erforschte Wirkstoffe und neu entwickelte Medikamente sind, die ihnen nach einem langen Leidensweg endlich geholfen haben. Erfahrungen von Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis: Schau Dich in unserem Forum um. Wie wir wissen, sind das aber auch meist die sehr teuren Präparate. Die Öffentlichkeit soll davon überzeugt werden, dass Forschung nicht nur sinnvoll ist, sondern auch ihren Preis hat. Teure Forschung müssen die Krankenkassen über die Medikamentenpreise finanzieren. Der Patient, der davon überzeugt ist, dass neue Medikamente ihm helfen könnten, fordert sie von seinem Arzt und seiner Krankenkasse. Das bezahlen alle Kassenmitglieder über die Beiträge mit. Niemand wird der Pharmaindustrie vorwerfen, dass sie die zwei Milliarden Euro Forschungsausgaben in Deutschland über die Preise der Präparate finanzieren will. Jeder wird verstehen, dass neue Medikamente deshalb teuer sind. Das Problem aber ist, dass für Werbung doppelt so viel ausgegeben wird – nämlich vier Milliarden Euro pro Jahr. (1) Zum Beispiel auch für solche Kampagnen wie „Forschung ist die beste Medizin“. Auch dieses Geld wird über die Preise der Medikamente von der Gemeinschaft der Krankenkassen-Mitglieder bezahlt. Um wie viel könnten diese Medikamente billiger sein, wenn solche Werbeausgaben wegfallen würden!? Quelle: (1) Glaeske/Schubert, zitiert in FAZ.NET vom 04.12.06, „Finanzierung von Selbsthilfegruppen – Wer hat so viel Geld“ von Magnus Heier Beispiel für den Fernsehspot eines Nieren-Patienten: Mehr zum Thema im Psoriasis-Netz ➔ Übersicht: Hier werden aktuell Studienteilnehmer gesucht ➔ Tipps: Studien – was sie bringen, was du wissen solltest ➔ Lexikon: Fachbegriffe von A bis Z -
Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit, sich um die Gesundheit zu kümmern! Alle zwei Wochen geben wir hier Tipps, welche Artikel, Videos oder Audios für Menschen mit Schuppenflechte oder Psoriasis arthritis interessant sein könnten. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und manchmal auch Unterhaltung! Huh! TikTok! Gefährlich! (Klicks!) 🚨 Alle paar Monate tauchen in Medien aller Art Warnungen auf. Die lauten ungefähr so: Eine neue TikTok-Challenge geht grad rum, Menschen machen gefährliche Dinge, schlimme Folgen, nicht machen! Für nicht so TikTok-affine Menschen: Das sind "Herausforderungen", Wettbewerbe. Menschen machen Dinge, filmen sich dabei, laden die Videos bei TikTok hoch und beweisen so ihren Mut oder ihre Dummheit. Man kann diese Challenges hirnverbrannt finden oder harmlosen Zeitvertreib – doch bei denen, vor denen in Medien gewarnt wird, ist das so eine Sache: Sie müssen nicht stimmen. Irgendwer setzt sie in die Welt und dann kommen alle möglichen Institutionen, Organisationen, Leute, die das für PR in eigener Sache nutzen – auch Ärzteverbände oder Kliniken. (skeptix.org) Menschen mit Schuppenflechte haben öfter Darmprobleme 🤰 In einer Studie wurden Proben aus Dick- und Dünndarm genommen – und zwar bei 18 Menschen mit Psoriasis und bei 15 ohne. Bei keinem Teilnehmer war vorher eine Darmerkrankung bekannt. Unter dem MIkroskop stellte sich heraus, dass die Hälfte der Menschen mit Schuppenflechte eine zu durchlässigen Darmbarriere. hatte. Das Problem wird oft als Leaky-gut-Syndrom bezeichnet. Die Forscher schreiben als Fazit ihrer Studie: Heißt: Wenn Ihr Probleme mit dem Darm habt und keine Idee, was los ist, fragt einen Gastroenterologen um Rat und erzählt ihm von eurer Psoriasis. Aber macht Euch nicht verrückt. Und Achtung, eine Studie mit 18 erkrankten Personen ist eine kleine Studie. Wie sehr oft, muss eine Studie mit mehr Teilnehmern das Restultat bestätigen. (aponet.de) Big Pharma: Wer kontrolliert das Milliardengeschäft? 💊 Immer sonntags gibt es neue Folgen von "Mai Think X" – einer Wissens-Show. Die erste Folge der neuen Staffel befasst sich mit einem kritischen und differenzierten Blick auf die Pharmaindustrie. Er thematisiert sowohl reale Skandale als auch unbegründete Verschwörungstheorien in diesem Bereich. Auch an den nächsten Sonntagen lohnt das Einschalten (bzw. der Blick in die Mediathek) – es geht noch öfter um Gesundheitsthemen. 👉 Tipp: Wollt Ihr keine Hör- und Gucktipps verpassen? Dann klickt oben auf "abonnieren". Ihr erhaltet dann bei jedem neuen Beitrag eine Benachrichtigung.
-
- Darm
- Morbus Crohn
-
(und 2 mehr)
Markiert mit:
-
Erfahrungen austauschen über das Leben mit Schuppenflechte, Psoriasis arthritis und dem ganzen Rest